Familien- und Gemeinschaftsformen am Übergang zur Moderne
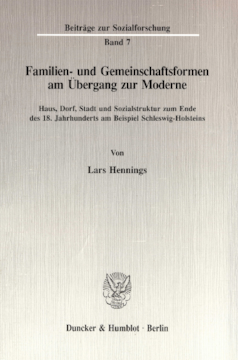
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Familien- und Gemeinschaftsformen am Übergang zur Moderne
Haus, Dorf, Stadt und Sozialstruktur zum Ende des 18. Jahrhunderts am Beispiel Schleswig-Holsteins
Beiträge zur Sozialforschung, Vol. 7
(1995)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Inhaltsverzeichnis | 5 | ||
| A. Einleitung – Das “Ganze Haus” reicht für die Analyse nicht | 7 | ||
| I. Sechs Problemstellungen | 9 | ||
| II. Die sozialen Gruppen – erste Kennzeichnung | 17 | ||
| B. Haushaltsformen und Individuation | 23 | ||
| I. Zu den Bauern | 24 | ||
| II. Zum Bürgertum | 26 | ||
| III. Handwerk und Gewerbe | 30 | ||
| IV. Frauenarbeitund “die Produktion” | 31 | ||
| V. Individuation als Parameter der Familiensoziologie | 32 | ||
| C. Quellen und Untersuchungsgebiet | 37 | ||
| D. Zum Konzept sozialer Ungleichheit – Lagen und Milieus | 43 | ||
| I. Zur Bestimmung der städtischen sozialen Lagen | 47 | ||
| II. Wer waren die Bauern? | 50 | ||
| E. Zur Sozialstruktur – die Gruppen der Vormoderne | 53 | ||
| I. Soziale Lage (2): Besitz- und Bildungsbürgertum, reiche Gewerbe | 53 | ||
| II. Soziale Lage (3): Hufner mit Altenteilen | 59 | ||
| III. Exkurs: Leibeigenschaft in Schleswig-Holstein und Cismar | 64 | ||
| IV. SozialeLage (4): Kätner, Bödner, Instenkätner (Kleinbesitz) | 66 | ||
| V. Die Bauern-Anwesen waren mehr als das “Ganze Haus” | 70 | ||
| VI. SozialeLage (5): Handwerk/Gewerbe – 1. Landgewerbe | 74 | ||
| VII. Soziale Lage (5): Handwerk/Gewerbe – 2. städtisches Handwerk | 77 | ||
| VIII. Soziale Lage (6): Arbeitsleute/Tagelöhner – 1. Arbeitsleute | 87 | ||
| IX. Soziale Lage (6): Arbeitsleute/Tagelöhner – 2. ländliche Tagelöhner | 89 | ||
| X. Soziale Lage (7): Arme und Alte | 90 | ||
| XI. SozialeLage (8): Gesinde | 91 | ||
| XII. Exkurs: Frauen, Männer, die Ehe und der soziale Status | 93 | ||
| F. Ein simples Modell der Sozialstruktur | 97 | ||
| I. Einige Hinweise zum Alter | 104 | ||
| G. Die Volkszählungen von 1769 und 1803 | 111 | ||
| H. Die Strukturen der Städte und Dörfer | 125 | ||
| I. Segregation | 128 | ||
| II. Beispielhaft: Einige Dörfer | 134 | ||
| III. Städtische Strukturen, besonders Kiel 1803 und Eckernförde 1769 | 136 | ||
| IV. Exkurs: Kiel 1781–1803, ein Beispiel innerstädtischen Wandels | 142 | ||
| V. Zur Steuerverteilung in den Städten | 150 | ||
| I. Familien- und Gemeinschaftsformen – Schlußbemerkung | 153 | ||
| Literaturverzeichnis | 167 | ||
| Sachverzeichnis | 171 | ||
| Anhang | 175 | ||
| Karte | 176 | ||
| Erläuterungen | 178 | ||
| Verzeichnisse der Tabellen, Graphiken, Kästen, Karte | 182 |
