Informationsfreiheit als Grenze informationeller Selbstbestimmung
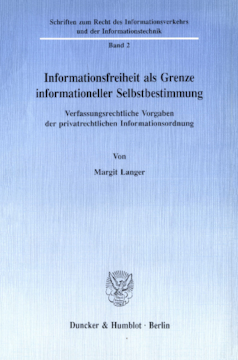
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Informationsfreiheit als Grenze informationeller Selbstbestimmung
Verfassungsrechtliche Vorgaben der privatrechtlichen Informationsordnung
Schriften zum Recht des Informationsverkehrs und der Informationstechnik, Vol. 2
(1992)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 5 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 7 | ||
| Abkürzungsverzeichnis | 12 | ||
| Teil 1: Die grundgesetzliche und privatrechtliche Informationsordnung | 15 | ||
| 1. Abschnitt: Einführung in das Problem | 15 | ||
| 2. Abschnitt: Wesen und Bedeutung der Information in der Gegenwart | 16 | ||
| A. Der Informationsbegriff | 16 | ||
| B. Die Bedeutung der Information in der Gegenwart | 18 | ||
| 3. Abschnitt: Die Informationsordnung des Grundgesetzes | 21 | ||
| A. Der Begriff der Informationsordnung | 21 | ||
| B. Information als grundgesetzliche Leitidee | 23 | ||
| I. In den Normen des Grundrechtskataloges | 23 | ||
| 1. Art. 5 I S. 1 GG | 23 | ||
| 2. Art. 8 und 9 GG | 23 | ||
| 3. Art. 5 III GG | 25 | ||
| 4. Art. 3 III GG | 25 | ||
| 5. Art. 4 I GG | 25 | ||
| 6. Art. 10 GG | 26 | ||
| 7. Art. 12 und 14 GG | 26 | ||
| 8. Art. 2 I GG als Auffanggrundrecht | 26 | ||
| II. In Normen außerhalb des Grundrechtskataloges | 28 | ||
| III. Untersuchungsgcgcnstand und Gang der Untersuchung | 29 | ||
| 4. Abschnitt: Der lange Kampf um die Meinungs- und Informationsfreiheit | 31 | ||
| A. Die geschichtliche Entwicklung | 31 | ||
| I. Die Meinungsfreiheit im Altertum und im Mittelalter | 31 | ||
| II. Die Entwicklung vom Anbruch der Neuzeit bis zur französischen Revolution | 32 | ||
| III. Die Entwicklung in Deutschland – Von der Meinungs- zur Informationsfreiheit | 35 | ||
| IV. Die internationale Anerkennung der Informationsfreiheit | 38 | ||
| B. Die ideengeschichtlichen Wurzeln der Meinungs- und Informationsfreiheit | 40 | ||
| I. Die objektive Wurzel der Meinungsfreiheit | 40 | ||
| II. Die subjektive Wurzel der Meinungsfreiheit | 42 | ||
| III. Die geistesgeschichtlichen Wurzeln der Informationsfreiheit | 43 | ||
| IV. Gedankenfreiheit als übergeordnetes Schutzgut der Meinungs- und Informationsfreiheit | 44 | ||
| 5. Abschnitt: Die privatrechtliche Informationsordnung | 47 | ||
| A. Informationsfreiheit als Grundprinzip der herkömmlichen Informationsordnung | 47 | ||
| I. Informationsansprüche | 49 | ||
| II. Informationsbeschränkungen | 52 | ||
| 1. §§ 824, 826 BGB | 52 | ||
| 2. § 823 BGB i.V.m. strafrechtlichen Schutzgesetzen | 52 | ||
| 3. Das Allgemeine Persönlichkeitsrecht | 54 | ||
| B. Von der Informationsfreiheit zum grundsätzlichen Informationsverbot | 59 | ||
| I. Das BDSG alter Fassung | 59 | ||
| II. Das novellierte BDSG und das „Recht auf informationelle Selbstbestimmung“ | 60 | ||
| Teil 2: Die Rechte der Meinungsäußerungs- und Informationsfreiheit im Sinne von Art. 5 I S. 1 GG | 66 | ||
| 6. Abschnitt: Grundrechtsverständnis und Grundrechtsinterpretation | 66 | ||
| A. Zur Auslegung der Grundrechte | 66 | ||
| B. Zur Theorie der Grundrechte | 68 | ||
| I. Die liberale Grundrechtstheorie | 69 | ||
| II. Die institutionelle Grundrechtstheorie | 70 | ||
| III. Die Werttheorie der Grundrechte | 70 | ||
| IV. Die demokratisch-funktionale Grundrechtstheorie | 71 | ||
| V. Die sozialstaatliche Grundrechtstheorie | 71 | ||
| C. Zur Anwendung der Auslegungsmethoden und Grundrechtstheorien | 71 | ||
| 7. Abschnitt: Der Schutzbereich des Art. 5 I S. 1 GG im Hinblick auf die einzelnen Phasen der Datenverarbeitung | 73 | ||
| A. Der geschützte Personenkreis | 73 | ||
| I. Natürliche Personen | 73 | ||
| II. Juristische Personen des Privatrechts | 75 | ||
| III. Anwendung auf Art. 5 I S. 1 GG | 78 | ||
| 1. Reisnecker und Wohland | 78 | ||
| 2. Herrschende Meinung | 79 | ||
| 3. Stellungnahme | 79 | ||
| B. Das grundsätzliche Verbot der Datenübermittlung als Eingriff in das Recht der Meinungsfreiheit gemäß Art. 5 I S. 1 erster Halbsatz GG | 82 | ||
| I. Meinungsbegriff | 82 | ||
| 1. Personenbezogene Daten als Meinung? | 82 | ||
| a) Der Begriff der personenbezogenen Daten | 83 | ||
| b) Der individualrechtliche Gehalt der Meinungsfreiheit | 86 | ||
| aa) Rothenbüchcr | 87 | ||
| bb) Ridder | 87 | ||
| cc) Leisner | 88 | ||
| dd) Neuere Literatur und Rechtsprechung | 88 | ||
| ee) Stellungnahme | 89 | ||
| c) Tatsachenmitteilungen als Meinung im verfassungsrechtlichen Sinn? | 96 | ||
| aa) Enger Meinungsbegriff | 97 | ||
| bb) Weiter Meinungsbegriff | 98 | ||
| cc) Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts | 98 | ||
| dd) Kritische Würdigung | 99 | ||
| II. Verarbeitungsformen Wort, Schrift und Bild | 104 | ||
| III. Datenerhebung als Recht der freien Meinungsäußerung? – Zugleich grundsätzliche Überlegungen zum Verhältnis des Art. 5 I S. 1 erster zum zweiten Halbsatz GG | 106 | ||
| IV. Sonderproblem: Datenbanken | 110 | ||
| 1. Der Begriff der Datenbank | 110 | ||
| 2. Datenbanken in der Wirtschaft | 111 | ||
| a) Die Schufa | 111 | ||
| b) Die Schimmelpfeng GmbH | 112 | ||
| 3. Tätigkeit der Datenbanken als Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung? | 113 | ||
| C. Grundsätzliches Verbot der Datenerhebung, -speicherung, -veränderung und -nutzung als Beeinträchtigung der Informationsfreiheit im Sinne von Art. 5 I S. 1 zweiter Halbsatz GG | 117 | ||
| I. Der individualrechtliche Gehalt der Informationsfreiheit | 117 | ||
| II. Die einzelnen Phasen der Datenverarbeitung als „sich unterrichten“ | 121 | ||
| 1. Datenerhebung | 121 | ||
| 2. Datenspeicherung | 123 | ||
| 3. Datenveränderung und -nutzung | 125 | ||
| III. „Allgemein zugängliche Informationsquellen“ als Zentralbegriff der Informationsfreiheit im verfassungsrechtlichen Sinn | 127 | ||
| 1. Informationsquelle | 127 | ||
| 2. „Allgcmeinzugänglichkeit“ | 128 | ||
| a) Erster Definitionsversuch durch Ridder | 129 | ||
| b) Vertreter der älteren Literatur | 129 | ||
| c) Gesetze als Maßstab zur Bestimmung der Allgemeinzugänglichkeit | 130 | ||
| d) Definition des Bundesverfassungsgerichts und der neueren Literatur | 130 | ||
| e) Weitere Auslegung des Begriffs der Allgemeinzugänglichkeit | 135 | ||
| f) Kritische Würdigung – eigener Lösungsansatz | 140 | ||
| Teil 3: Datenschutzgesetze als allgemeine Gesetze im Sinne von Art. 5 II GG – Schranke der Meinungsäußerungs- und Informationsfreiheit? | 149 | ||
| 8. Abschnitt: „Allgemeine Gesetze“ als Grenze der Meinungs- und Informationsfreiheit | 149 | ||
| A. Der Begriff der „allgemeinen Gesetze“ | 149 | ||
| I. Die Lehren der Weimarer Zeit | 150 | ||
| 1. Häntschel | 150 | ||
| 2. Rothenbücher | 151 | ||
| 3. Anschütz und Gebhard | 152 | ||
| 4. Smend | 152 | ||
| II. Die heutigen Lehrmeinungen | 153 | ||
| III. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Begriff der „allgemeinen Gesetze“ | 154 | ||
| IV. Datenschutzgesetze als „allgemeine Gesetze“ | 161 | ||
| B. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit als Einschränkung der „allgemeinen Gesetze“ | 163 | ||
| I. Inhalt und richterliche Nachprüfbarkeit des Verhältnismäßigkeitsprinzips | 163 | ||
| II. Überprüfung der Datenschutzgesetze am Maßstab der Verhältnismäßigkeit | 167 | ||
| 1. Geeignetheit | 167 | ||
| 2. Erforderlichkeit | 169 | ||
| 3. Proportionalität | 172 | ||
| a) Feststellung der widerstreitenden Interessen | 176 | ||
| b) Bewertung und Gewichtung der Interessen | 176 | ||
| aa) Das Allgemeine Persönlichkeitsrecht und die Rechte aus Art. 5 I S. 1 GG | 176 | ||
| bb) Das „Recht auf informationelle Selbstbestimmung“ | 177 | ||
| c) Abwägung der widerstreitenden Interessen | 193 | ||
| 9. Abschnitt: Zusammenfassung: Informationsfreiheit als grundgesetzliches Leitprinzip für die gesetzliche Ausgestaltung der privatrechtlichen Informationsordnung | 205 | ||
| Literaturverzeichnis | 208 |
