Bestimmungsfaktoren der Geldpolitik der Deutschen Bundesbank
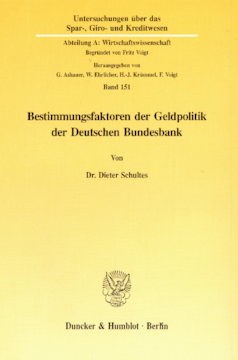
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Bestimmungsfaktoren der Geldpolitik der Deutschen Bundesbank
Untersuchungen über das Spar-, Giro- und Kreditwesen. Abteilung A: Wirtschaftswissenschaft, Vol. 151
(1994)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Inhaltsverzeichnis | 5 | ||
| Verzeichnis der Grafiken und Tabellen | 9 | ||
| I. Grafiken und Tabellen im Text | 9 | ||
| II. Grafiken und Tabellen im Anhang | 9 | ||
| Teil 1: Einleitung und Überblick | 11 | ||
| Teil 2: Grundprobleme der Bestimmung des Notenbankverhaltens | 18 | ||
| A. Überblick | 18 | ||
| B. Grundmodell zur Ableitung einer Reaktionsfunktion | 18 | ||
| I. Herleitung | 18 | ||
| II. Interpretation | 21 | ||
| C. Die dynamische Struktur der Reaktionsfunktion | 22 | ||
| I. Einleitung | 22 | ||
| II. Dynamische Wirtschaftsstruktur | 23 | ||
| 1. Einperiodische Lags | 23 | ||
| 2. Mehrperiodische Lags | 24 | ||
| III. Mehrperiodischer Planungshorizont | 27 | ||
| D. Reaktionsfunktion bei Unsicherheit | 31 | ||
| I. Einleitung | 31 | ||
| II. Unsicherheit in bezug auf die sonstigen vorherbestimmten Variablen | 33 | ||
| III. Unsicherheit in bezug auf die Wirkung der Instrumente | 33 | ||
| E. Schlußfolgerungen: Kernprobleme der empirischen Prüfung | 36 | ||
| I. Reaktionsfunktion in allgemeiner Form | 36 | ||
| II. Bestimmung der Variablen | 37 | ||
| 1. Zu erklärende Variablen | 37 | ||
| 2. Erklärende Variable | 38 | ||
| III. Schätzverfahren | 40 | ||
| IV. Stabilität der Verhaltensfunktionen | 40 | ||
| Teil 3: Ableitung und Spezifikation von Reaktionsfunktionen zur Beschreibung der Politik der Deutschen Bundesbank | 42 | ||
| A. Einleitung | 42 | ||
| B. Das geldpolitische Konzept der Bundesbank als Grundlage der empirischen Bestimmung des Zentralbankverhaltens | 43 | ||
| I. Institutioneller Rahmen und Ziele der Geldpolitik | 43 | ||
| II. Steuerungsverfahren der Bundesbank | 45 | ||
| 1. Geldmenge als geldpolitisches Zwischenziel | 45 | ||
| a) Funktion und Bestimmung des Geldmengenziels | 45 | ||
| b) Angekündigtes Geldmengenziel und die Bedeutung diskretionärer Elemente | 46 | ||
| 2. Kontrolle des monetären Zwischenziels | 49 | ||
| a) Geldpolitische Instrumente | 50 | ||
| b) Zweistufiges Steuerungsverfahren | 57 | ||
| c) Geldmarktsatz als Operationsziel | 59 | ||
| III. Fazit: Das geldpolitische Konzept der Bundesbank und die Ableitung von Reaktionsfunktionen | 63 | ||
| C. Reaktionsfunktion für das Operationsziel | 66 | ||
| I. Herleitung der Reaktionsfunktion | 66 | ||
| II. Spezifikation der erklärenden Variablen | 68 | ||
| 1. Bestimmung der erwarteten Geldmengenentwicklung E(Mt | IMt) | 68 | ||
| 2. Bestimmung der angestrebten Geldmengenentwicklung Mtz | 68 | ||
| a) Ableitung monatlicher Zielwerte aus dem angekündigten Geldmengenziel (MtanZ) | 69 | ||
| b) Berücksichtigung diskretionärer Elemente der Geldpolitik | 69 | ||
| III. Ergebnis: Die Schätzfunktion | 72 | ||
| IV. Reaktionsfunktion und Ziele im Bereich der Wechselkurse und des Außenwerts | 73 | ||
| D. Reaktionsfunktion für das Zwischenziel | 77 | ||
| Teil 4: Empirische Prüfung | 79 | ||
| A. Einleitung und Überblick | 79 | ||
| I. Zielsetzung | 79 | ||
| II. Vorgehen | 80 | ||
| B. Geldpolitische Instrument- und Zielvariablen: Bestimmung der Zeitreihen | 80 | ||
| I. Auswahl der Variablen | 81 | ||
| 1. Kurzfristiges Operationsziel | 81 | ||
| 2. Monetäres Zwischenziel | 81 | ||
| 3. Zielbereich: Geldwertstabilität | 82 | ||
| 4. Zielbereich: Außenwert der D-Mark, Wechselkurse | 83 | ||
| 5. Zielbereich: Wachstum, Konjunktur | 84 | ||
| II. Untersuchungszeitraum, Saisonbereinigung, Periodizität | 84 | ||
| C. Aufbereitung des Datenmaterials: Prüfung auf Stationarität und Bestimmung der angemessenen Transformation | 86 | ||
| I. Überblick | 86 | ||
| II. Autokorrelationsfunktion | 86 | ||
| III. Einheitswurzeln, Trend- und Saisontests | 87 | ||
| IV. Testergebnisse | 90 | ||
| 1. Zusammenfassung der Ergebnisse | 90 | ||
| 2. Die Ergebnisse für einzelne Gruppen von Variablen | 95 | ||
| D. Kausalitätstests | 97 | ||
| I. Testverfahren | 97 | ||
| 1. Konzept der Granger-Kausalität | 97 | ||
| 2. Schätzgleichungen und Tests | 98 | ||
| 3. Interpretation | 100 | ||
| 4. Bestimmung der Verzögerungslängen | 101 | ||
| a) Bestimmung des autoregressiven Prozesses | 101 | ||
| b) Lag-Struktur der unabhängigen Variablen | 102 | ||
| II. Testergebnisse | 102 | ||
| 1. Testreihen und Hypothesen zum Bundesbankverhalten | 102 | ||
| 2. Auswertung der Kausalitätstests | 104 | ||
| a) Kurzfristiges Operationsziel (RTA) und Geldmengenziel (M3) | 105 | ||
| b) Operationsziel (RTA), Zwischenziel (M3) und Preisvariablen | 106 | ||
| c) Operationsziel, Zwischenziel, DM-Außenwert und Wechselkurse | 112 | ||
| d) Operationsziel, Zwischenziel und Nettoproduktionsindex | 117 | ||
| III. Zusammenfassung und Interpretation der Testergebnisse | 119 | ||
| Teil 5: Zusammenfassung und Schlußbetrachtung | 123 | ||
| Anhang | 128 | ||
| A 1 Datenverzeichnis | 128 | ||
| A 2 Grafiken und Tabellen | 131 | ||
| I. Geldmarktsatz für Tagesgeld FfM (Grafik A1) | 132 | ||
| II. Autokorrelationskoeffizienten und Standardabweichung der Zeitreihen (Tab A1) | 133 | ||
| III. Einheitswurzeltests (Tab A2.1–Tab A2.5) | 134 | ||
| IV. Kausalitätstests (Tab A3.1a–Tab A4.2b) | 139 | ||
| A 3 Kausalitätstests – M3 mit 1. und 12. Differenzen transformiert | 147 | ||
| Literaturverzeichnis | 150 |
