Konfliktforschung und Konfliktbewältigung
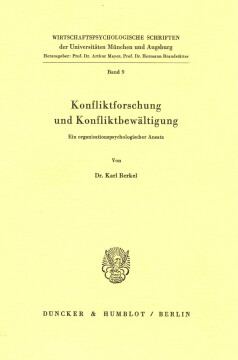
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Konfliktforschung und Konfliktbewältigung
Ein organisationspsychologischer Ansatz
Wirtschaftspsychologische Schriften, Vol. 9
(1984)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 3 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 5 | ||
| 1. Einleitung | 9 | ||
| 1.1. Warum und wozu untersucht die Organisationspsychologie Konflikt? | 9 | ||
| 1.2. Stand der Konfliktforschung in Organisationen | 12 | ||
| 1.2.1. Theoretische Ansätze | 12 | ||
| 1.2.1.1. Konflikt als abhängige Größe | 12 | ||
| Personenzentrierte Erklärungsansätze | 13 | ||
| Strukturzentrierte Erklärungsansätze | 15 | ||
| Integrative Ansätze | 17 | ||
| 1.2.1.2. Konflikt als unabhängige Größe | 20 | ||
| Konfliktbezogene Folgewirkungen | 20 | ||
| Konfliktübergreifende Folgewirkungen | 27 | ||
| Konflikt und Leistung | 28 | ||
| Konflikt und Zufriedenheit | 31 | ||
| 1.2.2. Methodische Schwerpunkte | 33 | ||
| Aktivität des Forschers | 34 | ||
| Systematik der Forschungsstrategie | 34 | ||
| 1.2.3. Interventionen | 35 | ||
| Situationsbezogene Interventionen | 36 | ||
| Personbezogene Interventionen | 37 | ||
| 1.2.4. Zusammenfassung des Überblicks und kritischer Kommentar | 37 | ||
| Zum theoretischen Verständnis von Konflikten | 38 | ||
| Zur Methodik | 43 | ||
| Zur Intervention | 45 | ||
| 1.3. Skizzierung des organisationspsychologischen Konfliktansatzes | 46 | ||
| Erster Teil: Perspektiven sozialwissenschaftlicher Konfliktforschung | 53 | ||
| 2. Der Konfliktbegriff | 54 | ||
| 2.1. Formalaspekt | 54 | ||
| 2.2. Materialaspekt | 55 | ||
| 2.2.1. Theoretisches Erkenntnisinteresse | 56 | ||
| 2.2.2. Pragmatisches Erkenntnisinteresse | 59 | ||
| 2.3. Konfliktbegriff als Interpretationsschema | 60 | ||
| 2.4. Der anthropologische Bezug jedes Konfliktbegriffs | 62 | ||
| 2.5. Folgerungen | 64 | ||
| 3. Der intrapersonale Konflikt | 67 | ||
| 3.1. Das homöostatische Konfliktmodell | 67 | ||
| Ein Beispiel: Konflikt in der Psychoanalyse | 67 | ||
| Kritik am homöostatischen Konfliktmodell | 69 | ||
| 3.2. Das kognitive Konfliktmodell | 72 | ||
| Ein Beispiel: Konflikt in der Entscheidungstheorie | 73 | ||
| Kritik am kognitiven Konfliktmodell | 75 | ||
| 3.3. Das phänomenologische Konfliktmodell | 78 | ||
| Konfliktbewältigung durch Strukturierung des Zukunftsbezugs | 82 | ||
| Bedeutung des phänomenologischen Ansatzes für eine organisationspsychologische Konfliktkonzeption | 86 | ||
| 4. Der interpersonale Konflikt | 88 | ||
| 4.1. Die personzentrierte Konfliktperspektive | 92 | ||
| 4.1.1. Das psychoanalytische Konfliktverständnis | 92 | ||
| Konflikt in der Gruppentherapie | 93 | ||
| Die minimal strukturierte Situation | 95 | ||
| Die drei Ebenen des „Göttinger Modells“ | 96 | ||
| Übertragbarkeit des psychoanalytischen Ansatzes auf Organisationen | 102 | ||
| 4.1.2. Das kognitive Konfliktverständnis | 105 | ||
| Die soziale Urteilstheorie | 106 | ||
| Konflikte im Rahmen des „Linsenmodells“ | 108 | ||
| Ein Anwendungsbeispiel | 111 | ||
| Kritische Anmerkungen | 116 | ||
| Zusammenfassung | 121 | ||
| 4.1.3. Das verstärkungstheoretische Konfliktverständnis | 122 | ||
| Ein Beispiel | 123 | ||
| Zusammenfassung und Kritik | 126 | ||
| 4.1.4. Zusammenfassende Schlußbetrachtung | 129 | ||
| 4.2. Die interaktionszentrierte Konfliktperspektive | 131 | ||
| 4.2.1. Reziprozität als Basismechanismus | 132 | ||
| 4.2.2. Die formale Seite von Reziprozität: Reaktionsprozesse und Reaktionskurven | 137 | ||
| 4.2.3. Die inhaltliche Seite von Reziprozität: Die Dimensionen sozialen Verhaltens | 146 | ||
| 4.2.3.1. Interaktion im Experiment: Die Spieltheorie | 150 | ||
| Beginn der Interaktion | 151 | ||
| Induktion von Deeskalation | 153 | ||
| Strategische Kooperation | 156 | ||
| 4.2.3.2. Interaktion unter Fremden: Die „Social Penetration“ Theorie | 159 | ||
| 4.2.3.3. Interaktion unter Ehepaaren: Liebe und Konflikt | 164 | ||
| Zusammenfassung von 4.2.1. bis 4.2.3. | 171 | ||
| 4.2.4. Interaktion als Konflikt und Konflitklösung: Der Ansatz von Morton Deutsch | 172 | ||
| 4.2.4.1. Struktur und Auswirkungen kooperativer und konkurrierender Situationen | 172 | ||
| 4.2.4.2. Konflikt in kooperativen und konkurrierenden Situationen | 177 | ||
| 4.2.4.3. Einige kritische Anmerkungen | 180 | ||
| Vernachlässigung der individualistischen Orientierung | 180 | ||
| Mehrdeutigkeit konkurrierenden Verhaltens | 182 | ||
| Grenzen von Deutsch’s Konflikttheorie | 183 | ||
| 4.2.5. Zusammenfassung und Schlußfolgerungen für die interaktionszentrierte Konfliktperspektive in Organisationen | 187 | ||
| 4.3. Die strukturzentrierte Konfliktperspektive | 194 | ||
| 4.3.1. Struktur und Prozeß | 196 | ||
| 4.3.2. Strukturkonflikte als Herrschaftskonflikte: Die Konflikttheorie von Ralf Dahrendorf | 201 | ||
| Einige kritische Anmerkungen | 205 | ||
| Die anthropologischen Vorannahmen struktureller Konfliktkonzeptionen | 211 | ||
| 4.4. Zusammenfassung und Folgerungen für einen organisationspsychologischen Konfliktansatz | 213 | ||
| Zweiter Teil: Konflikte in Organisationen | 220 | ||
| Kennzeichen des organisationspsychologischen Konfliktansatzes | 220 | ||
| Korrelation von Konfliktperspektive und Organisationskonzept | 223 | ||
| 5. Die personzentrierte Konfliktperspektive | 227 | ||
| Wandel in der Einstellung zur Arbeit | 227 | ||
| Der psychologische Kontrakt zwischen Person und Organisation | 229 | ||
| 5.1. Konflikt im Vollzug der Arbeit | 234 | ||
| Konfiguration des „inneren Arbeitskonflikts“ | 235 | ||
| Klinische Analyse von Arbeitsstörungen | 237 | ||
| Konflikt in der Leistungsmotivation | 240 | ||
| 5.2. Konflikt in der Rolle des Organisationsmitgliedes | 245 | ||
| Übernahme der organisatorischen Rolle | 246 | ||
| Ich-Funktionen der organisatorischen Rolle | 248 | ||
| Führung als Konflikt | 251 | ||
| Notwendigkeit eines erweiterten Rollenverständnisses | 254 | ||
| Exkurs: Konflikt und Streß | 255 | ||
| 6. Die interaktionszentrierte Konfliktperspektive | 260 | ||
| Organisation als Handlungsbezugsrahmen | 261 | ||
| 6.1. Attribuierungsprozesse | 265 | ||
| Persönliche und positionale Beziehungen | 266 | ||
| Die Gefahr eines künftig zunehmenden interaktiven Konfliktpotentials | 271 | ||
| 6.2. Kommunikation | 273 | ||
| Ein psychologisches Kommunikationsmodell | 273 | ||
| Sachebene | 277 | ||
| Selbstoffenbarung | 278 | ||
| Beziehung | 284 | ||
| Lenkung | 286 | ||
| Zusammenfassung | 292 | ||
| 6.3. Konfliktstile | 292 | ||
| Konzept | 292 | ||
| Operationalisierung | 294 | ||
| Kritik | 296 | ||
| 6.4. Gerechtigkeit als Konflikt | 298 | ||
| Die „Equity“ Theorie | 298 | ||
| Formen der Gerechtigkeit | 300 | ||
| Gerechtigkeit und Konfliktinteraktionen | 303 | ||
| 7. Die strukturzentrierte Konfliktperspektive | 306 | ||
| Organisationsstrukturen als Entäußerung kognitiver Prämissen und normativer Erwartungen | 306 | ||
| Die Merkmale bürokratischer Organisationen nach Max Weber | 308 | ||
| Organisationsstrukturen und Konflikt | 310 | ||
| 7.1. Differenzierung | 312 | ||
| 7.1.1. Aufgabendifferenzierung: Konflikt zwischen Spezialisten und Hierarchie | 312 | ||
| 7.1.2. Funktionsdifferenzierung: Konflikte zwischen Abteilungen | 317 | ||
| 7.1.3. Strukturelle Konfliktbewältigung: Differenzierung und Integration | 322 | ||
| 7.2. Formalisierung | 329 | ||
| 7.3. Hierarchie | 335 | ||
| Dritter Teil: Konfliktbewältigung und Konfliktforschung | 343 | ||
| 8. Prinzipien der Konfliktbewältigung | 343 | ||
| Personzentrierte Konfliktperspektive | 344 | ||
| Interaktionszentrierte Konfliktperspektive | 346 | ||
| Strukturzentrierte Konfliktperspektive | 346 | ||
| 8.1. Problematik des Begriffs Konflikt „lösung“ | 347 | ||
| 8.2. Konfliktbewältigung auf der Personebene: Umstrukturieren | 350 | ||
| 8.3. Konfliktbewältigung auf der Interaktionsebene: Steuerung | 354 | ||
| 8.4. Konfliktbewältigung auf der Strukturebene: Regelung | 356 | ||
| 8.5. Konfliktbewältigung durch Perspektivenwechsel | 359 | ||
| 9. Konfliktforschung in Organisationen | 362 | ||
| 9.1. Methoden organisationspsychologischer Konfliktforschung | 362 | ||
| 9.1.1. Phänomenologische Erhellung der Sinnstruktur eines Konflikts | 364 | ||
| 9.1.2. Beobachtung und Inhaltsanalyse | 367 | ||
| 9.1.3. Aktionsforschung | 372 | ||
| 9.1.4. Qualitative Einzelfallstudie als integrativer Forschungsrahmen | 376 | ||
| 9.2. Prinzipien organisationspsychologischer Konfliktforschung | 379 | ||
| Die zwei Aspekte menschlichen Verhaltens | 380 | ||
| Der grundsätzliche Konflikt des Organisationspsychologen | 383 | ||
| Der ethische Standort des organisationspsychologischen Forschers | 386 | ||
| Literaturverzeichnis | 389 | ||
| Autorenverzeichnis | 430 | ||
| Sachregister | 438 |
