Eigentum und Sozialhilfe
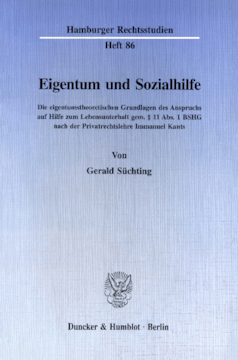
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Eigentum und Sozialhilfe
Die eigentumstheoretischen Grundlagen des Anspruchs auf Hilfe zum Lebensunterhalt gem. § 11 Abs. 1 BSHG nach der Privatrechtslehre Immanuel Kants
Hamburger Rechtsstudien, Vol. 86
(1995)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Inhaltsverzeichnis | 5 | ||
| Einleitung | 11 | ||
| A. Das geltende Recht der Hilfe zum Lebensunterhalt im Verhältnis zur Eigentumsgarantie | 19 | ||
| I. Die geschichtliche Entwicklung hin zum BSHG | 19 | ||
| II. Die Anspruchsvoraussetzungen der Hilfe zum Lebensunterhalt gem. § 11 I 1 BSHG | 23 | ||
| 1. Leistungshöhe | 24 | ||
| 2. Grundsätze der Sozialhilfeleistung | 28 | ||
| 3. Allgemeine Grundsätze des Sozialrechts | 32 | ||
| 4. Verfassungsrechtliche Einordnung der Hilfe zum Lebensunterhalt | 34 | ||
| 5. Zusammenfassung | 43 | ||
| III. Eigentumsbegriff und Eigentumsschutz von subjektiven öffentlichen Rechten | 44 | ||
| 1. Der Eigentumsbegriff aus verfassungsgerichtlicher Sicht | 45 | ||
| a) Der Eigentumsbegriff | 45 | ||
| b) Instituts- und Bestandsgarantie | 48 | ||
| c) Eigentumsgegenstand | 50 | ||
| d) Sozialpflicht | 52 | ||
| e) Verstärkter Vertrauensschutz für die Eigentümerposition | 54 | ||
| f) Zusammenfassung | 55 | ||
| 2. Eigentumsschutz subjektiver öffentlicher Rechte | 57 | ||
| a) Die Position des Bundesverfassungsgerichts | 57 | ||
| b) Kritik an den Kriterien des Bundesverfassungsgerichts und Darstellung der Kontroverse um den Eigentumsschutz subjektiver öffentlicher Rechte | 62 | ||
| aa) Kein subjektives öffentliches Recht habe Eigentumsqualität, auch nicht die vermögenswerten und erst recht nicht der Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt | 62 | ||
| bb) Einige der vermögenswerten subjektiven öffentlichen Rechte unterfallen der Eigentumsgarantie, jedoch nicht der Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt | 64 | ||
| cc) Alle vermögenswerten subjektiven öffentlichen Rechte unterfallen der Eigentumsgarantie, auch der Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt | 73 | ||
| 3. Grundlage: Definition des Eigentumsbegriffs, ausgehend vom Standpunkt des Bundesverfassungsgerichts | 73 | ||
| IV. Zusammenfassende Problemformulierung | 77 | ||
| B. Der vorpositive Begründungszusammenhang von Eigentum und Sozialhilfe | 79 | ||
| I. Einleitung | 80 | ||
| 1. Zur Rechtslehre Kants | 80 | ||
| 2. Die Modalkategorien in der Privatrechtstheorie | 82 | ||
| II. Die praktische Möglichkeit des Eigentums | 88 | ||
| 1. Die Modalkategorie der Möglichkeit | 88 | ||
| a) ... in der Erkenntnistheorie | 88 | ||
| b) ... und in der praktischen Philosophie | 89 | ||
| 2. Der Rechtsbegriff der Person | 93 | ||
| a) Erkenntnistheoretische Einführung in den Personenbegriff | 93 | ||
| aa) Das empirische Selbstbewußtsein | 95 | ||
| bb) Das reine Selbstbewußtsein | 96 | ||
| cc) Das Ich-an-sich | 97 | ||
| dd) Die Einheit des Erkenntnissubjekts | 97 | ||
| b) Der Grundsachverhalt des Rechts: Freiheit | 98 | ||
| aa) Die Möglichkeit, die Idee der Freiheit zu denken | 100 | ||
| bb) Freiheit als Prinzip menschlichen Handelns – Das reine praktische Subjekt | 102 | ||
| cc) Die Eigenständigkeit des Rechts gegenüber der Moral (und die einheitliche Fundierung beider in der Idee der Freiheit) | 108 | ||
| dd) Freiheit als rechtsphilosophischer Begriff | 111 | ||
| (1) Regulativ, nicht konstitutiv | 111 | ||
| (2) Das ursprüngliche Menschenrecht der Freiheit | 111 | ||
| ee) Das Rechtsverhältnis im allgemeinen und im strikten Sinne | 113 | ||
| ff) Der Andere im Recht | 117 | ||
| 3. Der Eigentumsgegenstand | 118 | ||
| a) Einleitung und Darstellungsziel | 118 | ||
| b) Erkenntnistheoretische Einführung: Phänomena und Noumena | 119 | ||
| c) Der Gegenstand im Rechtsverhältnis | 121 | ||
| aa) Der äußere Gegenstand: Sachen i. S. d. § 90 BGB | 122 | ||
| bb) Der innere Gegenstand | 123 | ||
| (1) Das „geistige“ Eigentum | 125 | ||
| (2) Forderungen | 126 | ||
| (a) Forderung aus Rechtsgeschäft | 126 | ||
| (b) Forderungen aus Gesetz | 128 | ||
| (aa) Gesetzliche Forderungen zwischen Privaten | 129 | ||
| (bb) Gesetzliche Forderungen der verfaßten Allgemeinheit gegen Private | 129 | ||
| (cc) Forderungen Privater gegen den Staat | 130 | ||
| (dd) Abgrenzung zur Konzession | 131 | ||
| (3) § 11 Nr. 1 S. 1 BSHG ist formell identisch mit sonstigen Ansprüchen des Forderungseigentums | 132 | ||
| 4. Die rechtliche Zuordnung: Die Herrschaft der Person über den Gegenstand | 133 | ||
| a) Einleitung und Darstellungsziel | 133 | ||
| b) Die Möglichkeit rechtlicher Herrschaft über Gegenstände, § 2 Metaphysik der Sitten/Rechtslehre | 134 | ||
| c) Die Intelligibelität der rechtlichen Zuordnung, §§ 6 und 7 Metaphysik der Sitten/Rechtslehre | 136 | ||
| aa) Die Deduktion des intelligibelen Besitzes, § 6 Metaphysik der Sitten/Rechtslehre | 136 | ||
| bb) Anwendung der Kategorie „intelligibeler Besitz“ auf einen Gegenstand des positiven Rechts, § 7 Metaphysik der Sitten/Rechtslehre | 139 | ||
| d) Vorläufige und gesicherte Gegenstandsherrschaft im Übergang vom Natur- zum bürgerlichen Zustand | 139 | ||
| 5. Schlußbemerkung zur Möglichkeit des Eigentums und Vorformulierungen zum Sozialrechtsverhältnis | 143 | ||
| a) Schlußbemerkung | 143 | ||
| b) Vorformulierungen zum Sozialrechtsverhältnis | 145 | ||
| III. Freiheitsverwirklichung in der Gegenständlichkeit – Erwerb und Gebrauch | 147 | ||
| 1. Einleitung und Darstellungsziel | 147 | ||
| 2. Die Modalkategorie der Wirklichkeit | 148 | ||
| a) ... in der theoretischen Philosophie | 148 | ||
| b) ... und in der praktischen Philosophie | 151 | ||
| 3. Ursprünglicher und abgeleiteter Erwerb | 152 | ||
| a) Einleitung | 152 | ||
| b) Der ursprüngliche Erwerb | 154 | ||
| c) Der abgeleitete Erwerb | 155 | ||
| 4. Der Vernunfttitel des Erwerbs | 157 | ||
| 5. Die Dynamik des Eigentums in der bürgerlichen Gesellschaft | 159 | ||
| IV. Die Notwendigkeit der Eigentumsregulation am Beispiel der Sozialhilfe | 165 | ||
| 1. Einleitung und Überblick | 165 | ||
| 2. Die Modalkategorie der Notwendigkeit | 169 | ||
| a) ... in der theoretischen Philosophie | 169 | ||
| aa) Formallogischer Begriff der Notwendigkeit | 169 | ||
| bb) Die „Realnotwendigkeit“ | 169 | ||
| b) ... und in der praktischen Philosophie | 171 | ||
| 3. Die Notwendigkeit des Eigentums und des Erwerbs – Ausschluß einer eigentumslosen Gesellschaft | 175 | ||
| 4. Rechtsphilosophische Rekonstruktion der Begriffe Bedürftigkeit und Hilfe | 178 | ||
| a) Der Begriff der Bedürftigkeit | 179 | ||
| aa) ... als individuelle Not | 179 | ||
| bb) ... und als intersubjektiver Mangel | 181 | ||
| b) Der Begriff der Hilfe | 182 | ||
| aa) Die private Hilfspflicht in positivgesetzlichen Ausformungen | 182 | ||
| bb) Der Staat als Garantengemeinschaft, 1. Teil | 184 | ||
| 5. Vier Aspekte der Staatspflicht zur Hilfe zum Lebensunterhalt | 185 | ||
| a) 1. Aspekt: Das allgemeine Rechtsprinzip | 186 | ||
| b) 2. Aspekt: Das Recht auf Teilhabe im ursprünglichen Gesamtbesitz | 191 | ||
| c) 3. Aspekt: Teilhaberecht am Obereigentum des Volkes | 196 | ||
| d) 4. Aspekt: Verteilungsgerechtigkeit im bürgerlichen Zustand | 202 | ||
| aa) Die Möglichkeit des Gegenstandsbesitzes im Rechtsverhältnis: Ausgleichende Gerechtigkeit | 206 | ||
| bb) Die Wirklichkeit des Besitzes der Gegenstände: Tauschgerechtigkeit | 207 | ||
| cc) Die Notwendigkeit des Besitzes von Gegenständen: Verteilungsgerechtigkeit | 209 | ||
| (1) Jede Person muß Teil an den Gegenständen haben, derer sie zum Dasein als eines soziokulturell-biologischen Mangelwesens bedarf (Grundbedürfnisbefriedigung eines jeden) | 210 | ||
| (2) Jeder Person sind gleiche Möglichkeiten zum Gegenstandserwerb zu eröffnen | 211 | ||
| (3) Im bürgerlichen Zustand sind Einrichtungen und Verfahren bereitzustellen, die Punkt Eins und Zwei regulativ nach Maßgabe der öffentlichen Gerechtigkeit verwirklichen | 211 | ||
| dd) Die Pflicht des Staates zur Hilfe zum Lebensunterhalt, Garantengemeinschaft 2. Teil | 212 | ||
| V. Zusammenfassung: Die Eigentumsqualität des Anspruchs auf Hilfe zum Lebensunterhalt im vorpositiven Sinne | 215 | ||
| C. Methodologische Schlußbetrachtung | 218 | ||
| I. Die methodologische Fragestellung | 218 | ||
| II. Dialektische Methode | 224 | ||
| 1. Auslegungen zu § 2 der Grundlinien der Philosophie des Rechts | 224 | ||
| 2. Auslegungen zu § 31 der Grundlinien der Philosophie des Rechts | 228 | ||
| III. Auslegung des Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG nach der dialektischen Methode | 230 | ||
| 1. Methodologischer Standpunkt des Bundesverfassungsgerichts | 230 | ||
| 2. Auslegung des Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG nach der dialektischen Methode i.S. Hegels | 233 | ||
| a) Auslegung nach dem Wortlaut | 233 | ||
| b) Auslegung nach der Teleologie | 235 | ||
| c) Auslegung nach dem System | 235 | ||
| d) Auslegung nach der Normgeschichte | 237 | ||
| IV. Ergebnis | 237 | ||
| Literaturverzeichnis | 240 |
