Das Sittengesetz als Schranke der Grundrechte
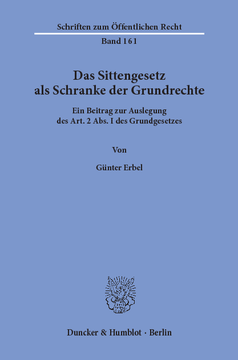
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Das Sittengesetz als Schranke der Grundrechte
Ein Beitrag zur Auslegung des Art. 2 Abs. I des Grundgesetzes
Schriften zum Öffentlichen Recht, Vol. 161
(1971)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 7 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 9 | ||
| Abkürzungeverzeichnis | 15 | ||
| Einleitung | 17 | ||
| 1. Notwendigkeit einer verfassungsrechtlichen Untersuchung des Sittengesetzes | 17 | ||
| 2. Der Wandel der gesellschaftlichen Moralauffassungen | 19 | ||
| 3. Gesamtverfassung und unterverfassungsrangige Rechtsordnung als notwendige Bezugspunkte der Interpretation | 24 | ||
| 4. Umfang, Grenzen und Methode der Untersuchung | 24 | ||
| Erster Teil: Die Auslegung des Sittengesetzes in Literatur und Rechtsprechung | 27 | ||
| A. Leugnung des Sittengesetzes | 28 | ||
| B. Das Sittengesetz als „vorgegebenes" oder gottgegebenes ewiges Gesetz (lex aeterna) | 31 | ||
| I. Schrifttum | 31 | ||
| 1. Hubmann | 31 | ||
| 2. Mahl | 31 | ||
| 3. H. Peters | 32 | ||
| 4. v. Mangoldt-Klein | 32 | ||
| 5. Potrykus | 32 | ||
| 6. Solcher | 32 | ||
| 7. Stümmer | 33 | ||
| 8. Weinkauff | 34 | ||
| II. Rechtsprechung des BGH | 34 | ||
| 1. „Kuppelei"-Entscheidung | 34 | ||
| 2. Andere Entscheidungen | 36 | ||
| (1) Einige „positivistische" frühe Entscheidungen | 37 | ||
| (2) Gesamtbild der Rechtsprechung: absolute Sollensethik | 39 | ||
| a) Entscheidung zum Selbstmord-Problem | 39 | ||
| b) Zumutbarkeit der Hilfeleistungspflicht im Rahmen des § 330 c StGB | 39 | ||
| c) Das Sittengesetz als Schranke der Gesetzgebung | 40 | ||
| d) Die Rechtsprechung zum Ehe-Recht | 40 | ||
| e) Sittenwidrigkeit der „Mätressen"-Testamente | 42 | ||
| III. Vereinzelte Entscheidungen anderer (unterer) Gerichte | 43 | ||
| 1. OLG Bamberg (Kriegsrecht) | 43 | ||
| 2. OLG Celle (Familienrecht) | 43 | ||
| 3. Dienststrafhof Schleswig-Holstein (Ehebruch) | 44 | ||
| 4. Entscheidungen verschiedener Gerichte zur letzten ethischen Begrenzung staatlicher Macht | 44 | ||
| IV. Entscheidungen auf dem Gebiet des „literarischen Jugendschutzes" | 45 | ||
| 1. Spruchpraxis der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften | 45 | ||
| 2. Richterliche Entscheidungen | 47 | ||
| (1) Verwaltungsgericht Köln | 47 | ||
| (2) OVG Münster | 48 | ||
| C. Das Sittengesetz als zeit- und anschauungsbedingtes Gesetz (als Inbegriff der kraft Tradition, sozialer Anerkennung und tatsächlicher Befolgung geltenden sittlichen Normen) | 50 | ||
| I. Die Rechtsprechung | 51 | ||
| 1. Das Bundesverfassungsgericht | 51 | ||
| (1) Urteil zu § 175 StGB | 51 | ||
| (2) „Lüth"-Urteil | 55 | ||
| (3) Zusammenfassende Analyse der beiden Urteile | 57 | ||
| (4) Entscheidungen zur Frage der letzten sittlichen Grenzen staatlicher Macht | 61 | ||
| (5) Entscheidungen zum Phänomen des „Gewissens" (Art. 4 III) | 62 | ||
| 2. Das Bundesverwaltungsgericht | 66 | ||
| (1) „Sünderin"-Film-Urteil | 66 | ||
| (2) Andere Entscheidungen in ethischen Fragen | 70 | ||
| a) Uneinheitliche Terminologie und unscharfe Verwendung ethischer Begriffe | 70 | ||
| b) Versuch eines systematisierten Überblicks | 71 | ||
| (a) Entscheidungen, die ausdrücklich auf das „Sittengesetz" Bezug nehmen | 71 | ||
| aa) Verbindlichkeit des Sittengesetzes als Rechtsschranke der freien Persönlichkeitsentfaltung | 71 | ||
| bb) Sittengesetz und Homosexualität | 71 | ||
| cc) Sittengesetz und (sittliche) Pflicht zur Eheschließung | 72 | ||
| dd) Geltung des Sittengesetzes auch für den Staat (absoluter Kern des Sittengesetzes) | 74 | ||
| (b) Entscheidungen, die allgemein auf ethische Wertvorstellungen der Rechtsgemeinschaft abstellen (unter Betonung unserer Rechtsgemeinschaft) | 75 | ||
| (c) Die Wandelbarkeit der (rechtsrelevanten) Sozialethik | 76 | ||
| (d) Das Problem der Erkenntnis (Feststellung) ethischer Normen | 77 | ||
| (e) Konkretisierung sittlicher Wertvorstellungen durch den Gesetzgeber (Rechtssicherheit) | 78 | ||
| 3. Rechtsprechung anderer Gerichte | 81 | ||
| (1) OLG Düsseldorf (Verlobtenverkehr unzüchtig?) | 81 | ||
| (2) OLG Braunschweig (Lesbische Liebe) | 82 | ||
| (3) VGH Stuttgart (Verkauf von Gummischutzmitteln aus Straßenautomaten) | 82 | ||
| (4) OVG Hamburg (Beförderungsverbot für „unsittliche Drucksachen" durch die Post) | 84 | ||
| (5) Schwurgericht Köln (Sittengesetz und strafrechtliche Schuld) | 85 | ||
| (6) OGHSt | 87 | ||
| a) Sittengesetz und Verschulden | 87 | ||
| b) Sittengesetz und rückwirkende Bestrafung | 88 | ||
| (7) Kammergericht (KG) Berlin (Sittengesetz und Vernichtung „lebensunwerten Lebens") | 88 | ||
| (8) Bad.OLG Freiburg (Sittengesetz: Bewertung der Denunziation als Verbrechen gegen die Menschlichkeit) | 88 | ||
| (9) OGH (Brit. Zone) Köln, OLG Frankfurt und Württ.Bad. VGH: („allgemeines" bzw. „allgemein anerkanntes" Sittengesetz als Bindung des Richters) | 88 | ||
| (10) OVG Koblenz u. OVG Lüneburg („Sünderin"-Film) | 89 | ||
| (11) OVG Münster (Moralisch-ästhetische Bewertung von Werbeanlagen) | 93 | ||
| (12) OVG Koblenz (Der Film „Das Schweigen") | 96 | ||
| (13) Hess.StGH (Beisetzung einer Urne auf eigenem Grundstück — Verstoß gegen das Sittengesetz?) und OVG Berlin (Wartezeit für Umbettung einer Urne — gerechtfertigt durch das Sittengesetz?) | 98 | ||
| II. Das Schrifttum | 100 | ||
| 1. Begriffsumfang des Sittengesetzes | 101 | ||
| (1) Restriktive Auslegung | 101 | ||
| (2) Extensive Auslegung | 101 | ||
| 2. Inhaltliche Abgrenzung des Sittengesetzes von anderen normativen Ordnungen | 103 | ||
| 3. Begriffliche Abgrenzung des Sittengesetzes von anderen (rechts-)ethischen Begriffen (Fragen der Terminologie) | 107 | ||
| (1) Abgrenzung des „Sittengesetzes" von allgemeinen ethischen Begriffen | 108 | ||
| a) Henkel | 108 | ||
| b) H. J. Wolff | 111 | ||
| c) Schulz-Schaeffer | 111 | ||
| d) Pawlowski | 112 | ||
| e) v. Hartlieb | 112 | ||
| (2) Abgrenzung des „Sittengesetzes" von Rechtsbegriffen, die auf die Ethik verweisen | 113 | ||
| a) Abgrenzung von den (zivilrechtlichen) „guten Sitten" | 113 | ||
| b) Abgrenzung zu anderen, unterverfassungsrangigen Gesetzesbegriffen (z.B. „öffentliche Ordnung", „unzüchtig", „sittlich jugendgefährdend") | 114 | ||
| 4. Abgrenzung des „Sittengesetzes" vom „Staats-Gesetz" zum (objektiven) „Recht" überhaupt | 116 | ||
| (1) „Sittengesetz" und „Staats-Gesetz" | 116 | ||
| (2) Beziehung des Sittengesetzes zum (objektiven) Recht überhaupt | 117 | ||
| 5. Inhalt des Sittengesetzes | 118 | ||
| 6. Feststellung des Inhalts des Sittengesetzes in konkreten Konfliktsfällen zwischen Freiheit und ethischer Bindung (Erkenntnisproblem) | 120 | ||
| 7. Ein „einheitlich" oder „differenziert" geltendes Sittengesetz? | 126 | ||
| 8. Die allgemeine „verfassungspolitische" Funktion des Sittengesetzes | 127 | ||
| 9. Verhältnis des Sittengesetzes zu den anderen Grundschranken der Freiheit in Art. 21 („verfassungsmäßige Ordnung" und „Rechte anderer") | 129 | ||
| 10. Funktion des Sittengesetzes als Grundrechtsschranke im Gesamtsystem der Grundrechte | 130 | ||
| Zweiter Teil: Eigene Gedanken zur verfassungsrechtlichen Interpretation des Sittengesetzes | 133 | ||
| A. Der methodische Ansatz | 133 | ||
| I. Die Interpretation des Sittengesetzes: Ein philosophisches oder rechtliches Problem? | 133 | ||
| 1. Das Sittengesetz als außer-rechtlicher Begriff | 133 | ||
| 2. Die Verwandlung von Begriffen in „Rechts"-Begriffe | 134 | ||
| 3. Begriffsarten und Begriffsbildung im Verfassungsrecht | 134 | ||
| 4. Die Verfassung als funktionsbestimmender Zusammenhang für den Begriff „Sittengesetz" | 135 | ||
| 5. Gang der Untersuchung bei der Funktionsbestimmung | 136 | ||
| II. Zur Interpretationsmethode | 137 | ||
| 1. Der Methodenstreit: Zwei Hauptrichtungen | 138 | ||
| (1) Herkömmliche Interpretationslehre auf der Grundlage des „Willensdogma im Recht" | 138 | ||
| (2) Verfahren konkretisierender Interpretation („topisches" Denken) | 139 | ||
| 2. Stellungnahme und eigener methodischer Weg (Synthese zwischen „System"- und „Problem"-Denken) | 141 | ||
| 3. Eigene Methode und deren Anwendung bei der Auslegung des „Sittengesetzes" | 143 | ||
| (1) Verfassungsimmanente Funktion des Sittengesetzes | 143 | ||
| (2) Rechtliche Bedeutung im einzelnen | 144 | ||
| Β. Die Bedeutung des Sittengesetzes aus verfassungsrechtlicher Sicht | 145 | ||
| I. Die Funktion des Sittengesetzes nach der Verfassung | 145 | ||
| 1. Das Sittengesetz als ethische Klausel ohne rechtliche Bindungswirkung? | 145 | ||
| (1) Entsprechende Vorbilder in anderen deutschen Verfassungen | 145 | ||
| (2) Argumente pro und contra aus Wortlaut und Sinn des Art. 2 I | 146 | ||
| a) Folgerungen aus dem Begriff „Sittengesetz" selbst (Sittengesetz = Unterart des „Gesetzes" im juristischen Sinne?) | 146 | ||
| (a) „Sittengesetz" oder „Sittengesetze" | 146 | ||
| (b) Einwirkung der Nachbar-Schranke „verfassungsmäßige Ordnung" | 146 | ||
| (c) Verfassung als „Rechts"-Ordnung (Problem des „normativen Positivismus") | 147 | ||
| (d) Formales Argument aus der Terminologie der Verfassung | 150 | ||
| (e) Formales Gegen-Argument aus der Terminologie | 150 | ||
| (f) Der geistesgeschichtlich tradierte „normative" Sinn des Begriffs „Sittengesetz" | 151 | ||
| (g) Sittengesetz = „gute Sitten"? | 157 | ||
| (h) Das rechtsstaatliche Prinzip vom „Vorbehalt des Gesetzes" | 157 | ||
| (i) Ergebnis | 158 | ||
| b) Stellung des „Sittengesetzes" im Sinnzusammenhang des Art. 2 I | 158 | ||
| (a) Wortlaut des Art. 2 I | 158 | ||
| (b) Sinn und Zweck des Art. 2 I | 159 | ||
| aa) Bloße Proklamation eines idealtypischen Menschenbildes der Verfassung? | 159 | ||
| bb) Immanente ethische Begrenzung bereits im Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit? | 160 | ||
| cc) Rein ethisch – deklaratorische Funktion wegen der Relation zu den „Nachbar"- Schranken? | 165 | ||
| (aa) Die „Rechte anderer" | 165 | ||
| (bb) Die „verfassungsmäßige Ordnung" | 167 | ||
| dd) Deutung des Sittengesetzes als selbständige rechtliche Schranke der Freiheit? | 177 | ||
| (aa) Unmöglich wegen der Art der ethischen Postulate des Sittengesetzes? | 178 | ||
| (bb) Unmöglich aus rechtsstaatlichen Erwägungen der Rechtssicherheit? | 178 | ||
| (cc) Unmöglich wegen der thematischen Unbestimmtheit des zu begrenzenden Freiheitsrechts? | 180 | ||
| (dd) Unmöglich, weil Persönlichkeitskerntheorie das Sittengesetz als Schranke „leerlaufen" läßt? | 181 | ||
| (ee) Argument pro: Art. 1 III und rechtsethisches Konzept der Verfassung | 185 | ||
| (3) Ergebnis | 186 | ||
| 2. Die (verfassungs-)rechtstechnische Funktion des Sittengesetzes | 186 | ||
| (1) Freiheit und ethische Bindung als verfassungsrechtliches Leitbild und unabdingbares Postulat | 186 | ||
| a) Das Sittengesetz als objektive Wertentscheidung des Verfassungsrechts | 186 | ||
| b) Die Schranken des Art. 2 I als Bestandteile des Menschenbildes der Verfassung | 186 | ||
| (a) Die Rechte anderer | 187 | ||
| (b) Die verfassungsmäßige Ordnung | 187 | ||
| (c) Das Sittengesetz | 188 | ||
| c) Die Schranken des Art. 2 I, insbesondere das Sittengesetz, als unabänderliche Zuordnungselemente der Freiheit (Art. 79 III ) in einem demokratischen-sozialen Rechtsstaat | 188 | ||
| (2) Einzelne Folgerungen | 188 | ||
| a) Keine Freiheit ohne ethische Bindung | 188 | ||
| (a) Im Rahmen des Art. 2 I | 188 | ||
| (b) Im Gesamtkatalog der Grundrechte | 188 | ||
| (c) Im grundrechtlich ungeschützten Bereich der Handlungsfreiheit | 190 | ||
| b) Auswirkung des Sittengesetzes in verschiedenen Richtungen | 191 | ||
| (a) Bedeutung für den einzelnen | 191 | ||
| (b) Bedeutung für den Staat (Das Sittengesetz als „Ermächtigung" und „Richtlinie") | 192 | ||
| aa) Der Gesetzgeber als primärer Adressat (Ermächtigung und Verpflichtung) | 193 | ||
| bb) Bedeutung für die anderen Staatsorgane (verpachtender Auslegungsgrundsatz) | 195 | ||
| (3) Rechtstechnische Spezialfragen | 195 | ||
| a) Sittengesetz und staatliches Gesetz | 195 | ||
| (a) Sittengesetz als „Gesetzesvorbehalt" (im herkömmlichen Sinne)? | 195 | ||
| (b) Sittengesetz als Verfassungsvorbehalt zur Interpretation immanenter Grundrechtsschranken | 197 | ||
| aa) Sittengesetz nur Legitimation bereits bestehender rechtlicher Konkretisierungen ethischer Postulate? | 197 | ||
| bb) Zwei Hauptformen der Ausgestaltung des Sittengesetzes durch den Gesetzgeber | 199 | ||
| (aa) Materielle Konkretisierung | 199 | ||
| (bb) Formale Konkretisierung | 199 | ||
| (c) Verpflichtung des Gesetzgebers, Sittengesetz durch (staatliches) Gesetz zu verdeutlichen? | 199 | ||
| b) Begriffliche Einordnung des Sittengesetzes in die technisch-juristischen Begriffskategorien | 200 | ||
| (a) Wesensbegriff, der auf ethische Werte geht | 200 | ||
| (b) Wertausfüllungsbedürftiger Verfassungsbegriff | 200 | ||
| (c) Ausprägung des Sittengesetzes in unterverfassungsrangigen ethischen Begriffen und Generalklauseln | 201 | ||
| (d) Das Sittengesetz im unmittelbaren (originären) Anwendungsbereich | 201 | ||
| aa) Gegenüber Gesetzgeber: politischer Ermessensbegriff | 202 | ||
| bb) Gegenüber Rechtsprechung und Verwaltung: Wertbegriff mit normativem Gehalt | 202 | ||
| c) Funktionelle Abgrenzung und Interdependenz des Sittengesetzes zu den Nachbarschranken („verfassungsmäßige Ordnung" und „Rechte anderer") | 203 | ||
| (a) Sittengesetz als rechtsphilosophische Urschranke der Freiheit | 203 | ||
| (b) Sittengesetz als juristische Auffangschranke zu den „speziellen" Nachbarschranken | 204 | ||
| aa) Sittengesetz und Rechte anderer | 204 | ||
| bb) Sittengesetz und verfassungsmäßige Ordnung | 205 | ||
| (c) Sittengesetz als rechtsethische Kontrollschranke (Zusammenhang mit dem Widerstandsrecht gem. Art. 20 IV) | 209 | ||
| II. Der normative Gehalt des Sittengesetzes | 209 | ||
| 1. Der mögliche normative Gehalt des Sittengesetzes (verfassungsrechtlicher Rahmen) | 210 | ||
| (1) Das Sittengesetz als Mittel zur Realisierung des demokratischen und sozialen Rechtsstaats | 210 | ||
| a) Integration des Sittengesetzes in die Sphäre des Staates und seiner Rechtsordnung | 210 | ||
| b) Sittengesetz „von Haus aus" kein staatliches Gesetz | 210 | ||
| c) Das Sittengesetz in der Rechtsordnung des Staates und als Funktionselement im Rahmen der Staatszwecke | 211 | ||
| (2) Staaten mit totalitärer Ideologie in Verbindung mit dem ethischen Prinzip des Utilitarismus | 211 | ||
| a) Das nationalsozialistische Rechtsdenken und die ihm zugrundeliegende „sittliche" Idee | 212 | ||
| b) Der „Klassen"-Utilitarismus in den Staaten marxistisch-leninistischer Prägung (insbesondere die „sozialistische Moral" in der DDR) | 220 | ||
| (3) Der theologisch gerechtfertigte Staat (Staaten mit verfassungsrechtlichem Bekenntnis zu einer bestimmten Religion) | 227 | ||
| (4) Religiös-weltanschaulich „neutrale" Staaten? — Insbesondere: Der liberale Staat | 231 | ||
| (5) Der Positivismus (besonders in der Weimarer Epoche) | 235 | ||
| a) Positivismus als geistige Strömung | 235 | ||
| b) Der staatsrechtliche Positivismus | 235 | ||
| c) Gegenströmungen | 238 | ||
| d) Positivistischer Grundzug in Rechtsprechung und Lehre (RG-Rechtsprechung zum Begriff „gute Sitten") | 251 | ||
| 2. Das Sittengesetz im Sinne unserer Verfassung | 254 | ||
| (1) Das Sittengesetz: konkretisierbarer und realisierbarer normativer Gehalt | 254 | ||
| (2) Die verfassungsrechtlichen Bezugspunkte der Interpretation des Sittengesetzes | 256 | ||
| a) Weiterverweisung auf „überpositive" sittliche Prinzipien (insbesondere auf Naturrecht)? | 257 | ||
| (a) Entstehungsgeschichtliche „Ausgangsvermutung" | 257 | ||
| (b) Abkehr vom Rechtspositivismus, Besinnung auf (christlich-)naturrechtliches Gedankengut bei Entstehung des GG | 257 | ||
| (c) Sittengesetz als Generalverweisung auf irgendeine „überpositive" Wertordnung? | 258 | ||
| (d) Grundgesetz als „objektive Wertordnung" | 259 | ||
| (e) „Umschaltungs-Mechanismen" der Verfassung für eine modifizierte Drittwirkung der ethischen Wertentscheidungen | 260 | ||
| (f) Ergänzung der Verfassungsethik durch die Sozialmoral | 261 | ||
| (g) Verfassungsethik und Sozialmoral: praktisch „bedarfsdeckende" und allein zulässige Quellen für das Sittengesetz und andere ethische Generalklauseln | 261 | ||
| (h) Verfassungsimmanentes politisch-konkretes „Naturrecht" als Bezugspunkt des Sittengesetzes | 263 | ||
| (i) Naturrecht der Verfassung als „werdendes" Recht, als „konkret-utopisches" Naturrecht | 265 | ||
| (k) Folgerungen für das Sittengesetz (Frage der Wandelbarkeit) | 270 | ||
| b) Die Bezugspunkte: freiheitlichdemokratischer und sozialer Rechtsstaat | 270 | ||
| (a) Das Element der Freiheit zur persönlichen Selbstentfaltung | 270 | ||
| aa) Freie ethische Selbstbestimmung | 271 | ||
| bb) Grenzen für das Sittengesetz (prinzipiell keine Gesinnungsethik) | 272 | ||
| cc) Verbot jedes Einflusses des Staates in die geistig-sittliche Kernsphäre? | 274 | ||
| dd) Ethisch-erzieherischer Einfluß im schulischen Bereich | 275 | ||
| ee) Ethische Bewertung und Beeinflussung im Bereich des Strafrechts | 277 | ||
| ff) Anstalts- und Militär-„Seelsorge" | 283 | ||
| gg) Sonn- und Feiertagsschutz | 285 | ||
| hh) Besondere „Treue"-Pflichten | 291 | ||
| ii) Sittliche, charakterliche Eigenschaften in der Rechtsordnung | 293 | ||
| kk) Ethische Disziplinierung der Privat- und Intimsphäre? (Veranschaulicht am Strafrecht) | 294 | ||
| (b) Das Element des Sozialstaats | 334 | ||
| aa) Verhältnis von Sozialstaatsklausel und Sittengesetz | 340 | ||
| bb) Inhaltliche und funktionale Ausrichtung und Begrenzung des Sittengesetzes vom Sozialstaatsprinzip her | 341 | ||
| cc) Wahrung der „öffentlichen Sicherheit und Ordnung" als sozialethisches Elementargebot | 342 | ||
| dd) Verrechtlichte sozialethische Hilfspflichten | 352 | ||
| (c) Demokratische Prinzipien (insbesondere Volksherrschaft, repräsentative Demokratie und Mehrheitsprinzip, Maßgeblichkeit und Ermittlung „herrschender Meinungen") | 355 | ||
| (d) Prinzip der Rechtsstaatlichkeit | 378 | ||
| aa) Beachtung der „guten Sitten" im rechtsgeschäftlichen Verkehr | 378 | ||
| bb) Rechtssicherheit (Normklarheit, Justitiabilität wertausfüllungsbedürftiger Rechtsbegriffe) — Beispiel: „unzüchtig" i. S. von § 184 StGB) | 380 | ||
| cc) Der allgemeine Gleichheitssatz (Art. 3 I) als Grundelement des sozialen Rechtsstaats (Sittengesetz und schlichthoheitliche Verwaltung) | 390 | ||
| Literaturverzeichnis | 395 |
