Eigen-Verantwortung im Rechtsstaat
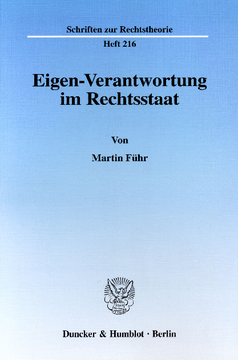
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Eigen-Verantwortung im Rechtsstaat
Schriften zur Rechtstheorie, Vol. 216
(2003)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 5 | ||
| Inhaltsübersicht | 7 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 9 | ||
| Abbildungsverzeichnis | 16 | ||
| Abkürzungsverzeichnis | 17 | ||
| Α. Einleitung | 21 | ||
| I. Ausgangsthese | 21 | ||
| II. Eigen-Verantwortung als Herausforderung für das Recht | 22 | ||
| 1. Grenzen imperativer Steuerung | 23 | ||
| 2. Erscheinungsformen rechtlicher Regulierung | 25 | ||
| 3. Responsives Recht | 28 | ||
| 4. Verknüpfungen zu den Verhaltenswissenschaften | 31 | ||
| 5. Ergebnis | 33 | ||
| III. Fragen an die Rechtswissenschaft | 33 | ||
| 1. Sinkende Gerechtigkeitsunmittelbarkeit des Rechts | 33 | ||
| 2. Prinzipienkonflikte im einfachen Recht | 35 | ||
| 3. Institutionelle Einbettung unvollkommener Pflichten | 36 | ||
| 4. Verantwortungsteilung und Verantwortungsvervielfachung | 38 | ||
| IV. Gang der Untersuchung | 39 | ||
| B. Eigen-Verantwortung als Kategorie des Rechts | 43 | ||
| I. Ausformung von „Verantwortung" | 43 | ||
| 1. Totalität der Verantwortung? | 43 | ||
| 2. Verantwortung als soziales Konstrukt | 46 | ||
| 3. Konstituierende Elemente | 47 | ||
| 4. Verantwortete Freiheit? | 50 | ||
| 5. Folgenanlastung und Verantwortungsinstanz | 51 | ||
| 6. Ergebnis | 53 | ||
| II. Verantwortungskategorien | 53 | ||
| 1. Begriff „Eigen-Verantwortung" | 54 | ||
| a) Unvollständige Programmierung | 55 | ||
| b) Dialogische Konstellationen | 56 | ||
| c) Institutionelle Einbettung | 57 | ||
| d) Individuelles Verhalten | 58 | ||
| 2. Abgrenzungen | 58 | ||
| a) Verhältnis zur „Verantwortlichkeit" | 59 | ||
| b) Verhältnis zur „Selbst-Verantwortung" | 62 | ||
| 3. Begriffsbestimmung | 64 | ||
| III. Unvollkommene Pflichten im Kontext von Recht und Tugend | 65 | ||
| 1. Trennung von Recht und Moral | 65 | ||
| a) System der Pflichten bei Kant | 66 | ||
| b) Pflichtcharakter als Trennungslinie | 69 | ||
| c) Perspektive der Nichtinterferenz | 73 | ||
| 2. Recht, Moral und Sittlichkeit bei Hegel | 76 | ||
| 3. Ergebnis | 79 | ||
| IV. Freiheits- und Staatsverständnis | 82 | ||
| 1. Freiheit vom Staat | 84 | ||
| 2. Präformiertes Freiheitsverständnis | 88 | ||
| a) Teilhabe-Perspektive | 89 | ||
| b) Kritik des „Eingriffsdenkens" | 92 | ||
| c) Ergebnis | 93 | ||
| 3. Erweitertes Freiheits Verständnis | 94 | ||
| a) Erweiterung der Grundrechtsfunktionen | 98 | ||
| b) Optimierung personaler Freiheit | 99 | ||
| c) Reduktionistische Dogmatik und Denkstil | 100 | ||
| 4. Überlagerung der Freiheitssphären | 101 | ||
| C. Unvollkommene Rechtspflichten als Rücksichtnahmegebot | 104 | ||
| I. Unvollkommene Pflichten in der RechtsanWendung | 104 | ||
| 1. Sorgfalt und Rücksichtnahme im Zivilrecht | 105 | ||
| a) Sorgfaltspflichten | 106 | ||
| aa) Weitere Verhaltenspflichten | 107 | ||
| bb) Gemeinsamkeiten der ergänzenden Sorgfaltspflichten | 108 | ||
| b) Obliegenheiten | 109 | ||
| c) Gemeinsame Funktionen | 109 | ||
| d) Ergebnis | 110 | ||
| 2. Rücksichtnahmegebote im Verwaltungsrecht | 111 | ||
| 3. Rücksichtnahmegebot im Baurecht | 112 | ||
| a) Anwendung in „unbeplanten" Bereichen | 112 | ||
| b) Ein Irrweg des Richterrechts? | 115 | ||
| 4. Zwischenergebnis | 117 | ||
| 5. Rücksichtnahme in der Verfassungsgerichtsrechtsprechung | 117 | ||
| a) Wechselbezügliche Verhältnismäßigkeit unter Privaten | 118 | ||
| b) Rücksichtnahme im Verhältnis Bürger-Staat | 121 | ||
| c) Ergebnis | 123 | ||
| 6. Konfliktkonstellationen | 124 | ||
| a) Offene Verhaltenspflichten im Gegenseitigkeitsverhältnis | 124 | ||
| b) Offene Verhaltenspflichten gegenüber dem Allgemeinwohl | 125 | ||
| aa) Global konkretisierte Steuerungsziele bei fehlender Individualisierung | 125 | ||
| bb) Individualisierte Pflichten bei fehlender Konkretisierung | 126 | ||
| c) Indirekt steuernde institutionelle Bedingungen | 128 | ||
| d) Übergreifende Fragestellungen | 129 | ||
| II. Verantwortungsteilung innerhalb der öffentlichen Gewalt | 129 | ||
| 1. Eigene Verantwortung der Kommunen | 131 | ||
| a) Aufgabenverteilungsprinzip | 132 | ||
| b) Organisationshoheit | 133 | ||
| c) Ergebnis | 136 | ||
| 2. Gubernative Eigen-Verantwortung | 137 | ||
| a) Handlungsmaßstab | 139 | ||
| b) Fehlende Kontrollinstrumente? | 139 | ||
| c) Ergebnis | 141 | ||
| 3. „Shared Responsibility" auf Gemeinschaftsebene | 142 | ||
| a) Loyale Zusammenarbeit in den Gemeinschaften | 143 | ||
| b) Handlungsformen der Gemeinschaften | 144 | ||
| aa) Empfehlung und Stellungnahme | 145 | ||
| bb) Richtlinie | 147 | ||
| c) Ergebnis | 148 | ||
| 4. Rücksichtnahmeforderungen im Bund-Länder-Verhältnis | 149 | ||
| 5. Ergebnis | 150 | ||
| III. Entstehungsvoraussetzungen und Rechtsfolgen von Rücksichtnahmegeboten | 152 | ||
| 1. Voraussetzungen | 152 | ||
| 2. Rechtsfolgen | 153 | ||
| a) Befugnisbegrenzende Anforderungen | 155 | ||
| b) Sorgfaltspflichten zugunsten des Gegenübers | 155 | ||
| c) Wechselbezügliche Verhältnismäßigkeitsprüfung | 158 | ||
| 3. Besonderheiten bei der Gewaltenkooperation | 160 | ||
| 4. Ergebnis | 160 | ||
| IV. Gegenseitigkeit und Rücksichtnahme in der Rechtstheorie | 160 | ||
| 1. Auflösung von Prinzipienkonflikten | 161 | ||
| a) „Wechselwirkungs-Theorie" | 161 | ||
| b) Verhältnismäßige Zuordnung konfligierender Prinzipiennormen | 162 | ||
| c) „Schonender Ausgleich" und „praktische Konkordanz" | 163 | ||
| d) Zwischenergebnis | 164 | ||
| e) Konflikt mit dem „Trennungsdenken" | 164 | ||
| f) Ergebnis | 169 | ||
| 2. Relativität und Solidarität | 170 | ||
| a) Wechselbezügliche Relativierung | 171 | ||
| b) Übermaßverbot im Gleichordnungsverhältnis | 171 | ||
| aa) Eingriff als Voraussetzung der Verhältnismäßigkeitsprüfung | 172 | ||
| bb) Juristisches Knappheitsproblem | 172 | ||
| cc) Vernunftgemäße Organisation gemeinsamen Freiheitsgebrauches | 173 | ||
| dd) Wohlfahrtsoptimierung und Solidarität | 176 | ||
| ee) Konsequenzen aus dem Solidaritätsgedanken | 179 | ||
| c) Ergebnis | 181 | ||
| 3. Wechselbeziehung ingerenter Freiheitssphären | 182 | ||
| a) Begründungsansätze | 183 | ||
| b) Einwände | 184 | ||
| c) Konflikt-Auflösung | 185 | ||
| d) Ergebnis | 186 | ||
| 4. Verfassungsrechtlicher „Schlüsselbegriff" | 187 | ||
| 5. Optimierung im System des Rechts | 189 | ||
| 6. Ergebnis | 191 | ||
| V. Freiheit in gegenseitiger Rücksichtnahme | 192 | ||
| 1. Anwendungsebenen des Rücksichtnahmegebotes | 192 | ||
| a) Appell zu nicht-hoheitlicher Lösung als Verfassungserwartung | 192 | ||
| b) Vorrang des Gesetzgebers | 195 | ||
| c) Judikative und administrative Auslegungs- und Gestaltungsspielräume | 196 | ||
| aa) Argumentationsstruktur bei Abwägungsproblemen | 196 | ||
| bb) Drittwirkungsproblematik | 197 | ||
| cc) Einfachgesetzliche Abwägung | 199 | ||
| d) Ergebnis | 200 | ||
| 2. (Grund-) Recht auf Rücksichtnahme? | 200 | ||
| a) Rücksichtnahme im Hoheitsverhältnis | 201 | ||
| b) Rücksichtnahme im Gleichordnungsverhältnis | 201 | ||
| c) Ergebnis | 205 | ||
| 3. (Grund-) Pflichtigkeit zur Rücksichtnahme? | 206 | ||
| a) Verhältnis zu den „Grundpflichten" | 207 | ||
| b) Verhältnis zu den Grundrechten | 208 | ||
| c) Ergebnis | 209 | ||
| 4. Inhalt und Funktion des Rücksichtnahmegebotes | 210 | ||
| VI. Anreizstruktur für die Akteure | 212 | ||
| 1. Anreizsituation privater Akteure | 213 | ||
| 2. Anreizsituation im Binnenbereich der öffentlichen Gewalt | 215 | ||
| 3. Ergebnis | 216 | ||
| D. Grundlagen juristischer Institutionenanalyse | 218 | ||
| I. Rationales Recht - rationales Verhaltensmodell | 219 | ||
| 1. Rationalität und Legitimation des Rechts | 219 | ||
| 2. Steuerungsfunktion des Rechts | 221 | ||
| 3. Erweiterung der Steuerungsformen | 222 | ||
| 4. Materielle Rationalitätskriterien des Rechts | 223 | ||
| 5. Grenzen materiell-rationaler Konfliktbewältigung | 224 | ||
| 6. Ergebnis | 225 | ||
| II. Auf dem Weg zu einer Verhaltenstheorie für das Recht | 226 | ||
| 1. Juristische Forderungen nach Realanalyse | 226 | ||
| 2. Das Menschenbild im Recht | 229 | ||
| 3. Verhaltensmodelle in der Rechtswissenschaft | 230 | ||
| 4. Rechtswissenschaft und Verhaltenswissenschaften | 235 | ||
| 5. Ergebnis | 238 | ||
| III. Elemente eines Verhaltensmodells | 239 | ||
| 1. Methodische Grundannahmen | 239 | ||
| 2. Ökonomische Effizienz und juristische Rationalität | 241 | ||
| a) Ökonomisches Prinzip und Effizienz | 242 | ||
| b) Gerechtigkeit und Effizienz | 247 | ||
| aa) Wohlfahrtsökonomischer Effizienzbegriff | 248 | ||
| bb) Zugang der Rechtswissenschaft | 250 | ||
| cc) Effizienz als Garant von Gerechtigkeit | 254 | ||
| c) Ökonomische Analyse und juristische Abwägung | 257 | ||
| d) Ergebnis | 260 | ||
| 3. Ökonomisches Modell menschlichen Verhaltens | 262 | ||
| a) Das klassische Modell des „homo oeconomicus" | 263 | ||
| b) Modellerweiterungen | 266 | ||
| c) Empirie der „Anomalien" und normative Bindungen | 267 | ||
| d) Nutzenfundierung normativer Bindungen | 271 | ||
| e) Bedeutung von Institutionen | 276 | ||
| 4. Institutionenökonomisches Verhaltensmodell | 278 | ||
| a) Rationalitätsbegriff | 279 | ||
| b) Besonderheiten des institutionenökonomischen Modells | 281 | ||
| c) Der Schritt zum „homo oeconomicus institutionalis" | 283 | ||
| d) Juristische Rezeption | 285 | ||
| IV. Erklärungsgehalt des institutionenökonomischen Modells | 285 | ||
| E. Grundrechtsprüfung aus der Wirkungsperspektive | 288 | ||
| I. Einführung | 288 | ||
| 1. Funktion des Eingriffs-Begriffes | 290 | ||
| 2. Informatorische Maßnahmen als Eingriff? | 291 | ||
| 3. Begriffliche Vorklärungen | 292 | ||
| 4. Zuordnung der Wertungsfragen | 295 | ||
| 5. Weitere Untersuchungsschritte | 297 | ||
| II. Beeinträchtigung der Verhaltensmöglichkeiten | 297 | ||
| 1. Freiheitsverkürzende Einwirkung | 298 | ||
| a) Perspektive des Grundrechtsträgers | 299 | ||
| b) Wirkungsanalyse als Ausgangspunkt normativer Zuordnung | 301 | ||
| c) Zwangsgleiche Wirkung | 303 | ||
| d) Ergebnis | 305 | ||
| 2. Bestimmung des Gewährleistungsinhaltes | 306 | ||
| a) Subjektive Perspektive | 306 | ||
| aa) Das Beispiel der Wettbewerbsfreiheit | 308 | ||
| bb) Präformierter Schutzbereich | 312 | ||
| cc) Ergebnis | 315 | ||
| b) Grundrechtliche Ordnungsintentionen | 315 | ||
| c) Kontextbezogene Schutzbereichsbestimmung | 318 | ||
| aa) Normative und „positive" Perspektive | 319 | ||
| bb) Noch einmal: Beispiel Wettbewerbsfreiheit | 322 | ||
| (1) Exklusives Recht auf Außendarstellung? | 323 | ||
| (2) Schutz der berufsbezogenen Ehre | 325 | ||
| (3) Hinweis auf gesetzeswidriges Verhalten | 329 | ||
| (4) Fazit | 330 | ||
| cc) Ergebnis | 331 | ||
| d) Normänderungsrisiko und grundrechtlicher Normbestandsschutz | 331 | ||
| e) Grenzfragen der Einwirkung | 336 | ||
| aa) Präferenzbildung, Menschenwürde und Persönlichkeitsrecht | 336 | ||
| bb) Geringfügigkeitsgrenze der Einwirkung | 339 | ||
| f) Ergebnis | 341 | ||
| 3. Zurechnung zur öffentlichen Gewalt | 342 | ||
| a) Finalität des hoheitlichen Vorgehens | 343 | ||
| b) Intensität der Grundrechtseinwirkung | 344 | ||
| c) Unmittelbarkeit des Wirkungszusammenhanges | 345 | ||
| d) Ergebnis | 348 | ||
| 4. Gesetzgeberische Einwirkungen ohne Beeinträchtigungsqualität? | 348 | ||
| 5. Zusammenfassung | 351 | ||
| III. Rechtfertigung der Beeinträchtigung | 352 | ||
| 1. Gesetzesvorbehalt | 353 | ||
| 2. Materielle Anforderungen und ihre Verbindungen zur ökonomischen Analyse | 356 | ||
| a) Grundsatz der Verhältnismäßigkeit | 357 | ||
| aa) Zielbestimmung | 358 | ||
| bb) Geeignetheit | 360 | ||
| cc) Erforderlichkeit | 360 | ||
| dd) Angemessenheit | 365 | ||
| ee) Ergebnis | 366 | ||
| b) Allgemeiner Gleichheitssatz | 366 | ||
| aa) Willkürverbot als Begründungszwang | 366 | ||
| bb) Gesteigerte Begründungsanforderungen | 367 | ||
| cc) Strukturiertes Wertungsproblem | 369 | ||
| dd) Einsatzmöglichkeiten verhaltenswissenschaftlicher Analyse | 370 | ||
| c) Ergebnis | 371 | ||
| 3. Reichweite der materiellen Rationalkriterien | 371 | ||
| a) Kontrollnorm und Maßstabsnorm | 372 | ||
| b) Materielle und prozedurale Rationalität | 376 | ||
| c) Verfassungsgerichtliche Kontrolldichte | 380 | ||
| d) Anreize für verfassungsrichterliche Zurückhaltung | 383 | ||
| e) Wertungsvorrang der Legislative und realwissenschaftliche Fundierung | 384 | ||
| 4. Ergebnis | 384 | ||
| IV. Zusammenfassung | 385 | ||
| F. Eigen-Verantwortung als Element rechtlicher Institutionenbildung | 386 | ||
| I. Verantwortungskategorien und ihre verhaltensbeeinflussende Wirkung | 386 | ||
| II. Rücksichtnahme als Leitbild der Institutionenevolution | 389 | ||
| III. Wahl der Steuerungsformen | 395 | ||
| 1. Verhaltensmodell als Grundlage der Instrumentenwähl | 395 | ||
| 2. Ansatzpunkte institutioneller Gestaltung | 397 | ||
| a) Bereitstellung und Verarbeitung von Informationen | 398 | ||
| b) Intrapersonelle Koordination | 399 | ||
| c) Binnenkoordination in Organisationen | 399 | ||
| d) Soziale Kooperation | 401 | ||
| 3. Ergebnis | 402 | ||
| IV. Anwendungsmöglichkeiten juristischer Institutionenanalyse | 402 | ||
| V. Verknüpfungsleistung des institutionenökonomischen Ansatzes | 404 | ||
| VI. Steuerung und Institutionenbildung als Interaktionsprozeß | 407 | ||
| 1. Funktion „symbolischer" Politik | 407 | ||
| 2. Ausfüllung unbestimmter Rechtsbegriffe und Generalklauseln | 409 | ||
| 3. Gegenstromprinzip evolutionärer Institutionenbildung | 411 | ||
| 4. Normative Kraft der Rechtsordnung | 412 | ||
| Entscheidungsregister | 415 | ||
| Literaturverzeichnis | 419 | ||
| Sachverzeichnis | 453 |
