Einführung in die Rechtsphilosophie für Unterricht und Praxis
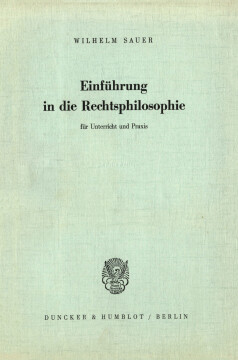
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Einführung in die Rechtsphilosophie für Unterricht und Praxis
(1961)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Aus dem Vorwort zur 1. Auflage | V | ||
| Vorwort zur japanischen Auflage | VII | ||
| Vorwort zu der Neuauflage | VII | ||
| Inhalt | XIII | ||
| Häufigere Abkürzungen | XVII | ||
| Erster Teil: Methodenlehre des Rechts | 1 | ||
| § 1. Aufgabe und Bedeutung der Rechtsphilosophie | 1 | ||
| I. Für die Philosophie ist sie eine Materie (Einzelwissenschaft wie die Ethik) | 2 | ||
| II. Für die Rechtswissenschaft ist sie zunächst Methode | 3 | ||
| 1. Ausgang vom Urteil, nicht vom Sein. Ontologie und Existenzphilosophie passen nicht für Sollenslehren | 3 | ||
| 2. Rechtsphilosophie beeinflußt auch allgemeine Lehren der Rechtswissenschaft, wird damit aber nicht zum „Naturrecht“ | 4 | ||
| III. Geschichte der Rechtsphilosophie | 7 | ||
| § 2. Die fünf Arbeitsweisen des Juristen | 9 | ||
| I. Das Urteil als Hauptarbeitsmittel jedes Juristen. Das Ergebnis ist konkretes Recht | 9 | ||
| II. Fünf Methoden | 9 | ||
| 1. Feststellung von Tatsachen | 9 | ||
| 2. Erklären, Verstehen, Begreifen | 10 | ||
| 3. Deuten, Auslegen | 11 | ||
| 4. Beurteilung nach Rechtsnormen | 13 | ||
| 5. Beurteilung nach der Rechtsidee | 14 | ||
| Tafel I: Methodischer Aufbau des Rechts | 14 | ||
| III. Stand der Ansichten | 15 | ||
| § 3. Logischer und organischer Aufbau der Rechtsordnung | 20 | ||
| I. Formal-logischer Charakter | 20 | ||
| 1. Zwangsordnung; Konflikte mit dem positiven Recht | 20 | ||
| 2. Unzulänglich ist Ausgang vom Rechtssatz. Falsch Imperativtheorie, richtig Anerkennungstheorie | 20 | ||
| 3. Weitere Mängel des Positivismus | 20 | ||
| II. Die organisch-funktionale Rechtsauffassung | 23 | ||
| 1. Dreigliedriger Aufbau; drei Seiten (Schichten, Dimensionen) des Rechts: aus dem sozialen Leben ergeben sich die Rechtsnormen und die Rechtsidee | 25 | ||
| 2. Konkrete Rechtsauffassung: Recht ist zu verwirklichendes Recht. Drei Definitionen | 25 | ||
| 3. Unentbehrlichkeit der drei Wissensmerkmale | 25 | ||
| 4. Berufs- und Völkertypen | 25 | ||
| III. Zum Stand der Literatur | 29 | ||
| IV. Praktische Bedeutung der Rechtsphilosophie | 31 | ||
| 1. Erläutert an einem Streitfall | 31 | ||
| 2. Notwendigkeit systematischen Denkens | 34 | ||
| 3. Vorblick. Literatur. Verhältnis von Soziologie und Rechtsphilosophie. Die „Natur der Sache“, „Sozialstruktur“, „Sozialordnung“; Methode des Völkerrechts | 35 | ||
| Zweiter Teil: Soziallehre des Rechts | 37 | ||
| § 4. Das staatlich-soziale Leben als Gegenstand des Rechts | 37 | ||
| I. Soziales Leben | 37 | ||
| 1. Willenshandlungen | 37 | ||
| 2. Freier Willensentschluß | 37 | ||
| II. Entwicklung der Willenshandlung | 37 | ||
| 1. Unlustgefühl; Erstreben eines subjektiven Wertes | 38 | ||
| 2. Einfluß der Umwelt | 38 | ||
| 3. Motive | 38 | ||
| 4. Willensentscheidung. Streit zwischen Determinismus und Indeterminismus | 38 | ||
| § 5. Soziale Gruppen | 40 | ||
| I. Arten | 40 | ||
| 1. Gemeinschaften; Wesen und Arten; Vorzüge | 40 | ||
| 2. Die Gesellschaft; die normative Kulturgemeinschaft der Menschheit | 42 | ||
| 3. Natürliche Gebilde: Horde, Masse | 43 | ||
| II. Folgerungen | 43 | ||
| § 6. Sozialer Wille, Rechtsordnung und Gemeinwohl | 44 | ||
| I. Gesamtwille? | 44 | ||
| 1. Zwei Theorien in Soziologie und Privatrecht (juristische Person) | 44 | ||
| 2. Ergebnis | 45 | ||
| 3. Verhältnis von Einzel- und Kollektivpsyche | 47 | ||
| 4. Das Wahlsystem als Symptom für Bildung des Gesamtwillens. Deutschland und England | 48 | ||
| 5. Völkerrechtlicher Gesamtwille | 49 | ||
| II. Soziale Ordnung, speziell Rechtsordnung | 49 | ||
| 1. Führertum und Führertugenden | 49 | ||
| 2. Die Geführten | 51 | ||
| 3. Die „soziale Frage“ | 51 | ||
| 4. Die „beste Staatsform“ | 53 | ||
| § 7. Gerechtigkeit und Gemeinwohl als Juristisches Grundgesetz | 55 | ||
| I. Praktische Bedeutung. Konfliktsfälle | 57 | ||
| II. Wesen der Gerechtigkeit | 58 | ||
| 1. Verhältnis zu Gemeinwohl und Rechtssicherheit | 58 | ||
| 2. Konfliktsfälle | 60 | ||
| 3. Hauptthema der „konkreten Rechtsphilosophie“. Normenkollisionen | 61 | ||
| III. Das Juristische Grundgesetz | 62 | ||
| 1. Das Gesetz der Gesetze | 62 | ||
| 2. Beziehungen zwischen Gerechtigkeit, Gemeinwohl und Rechtssicherheit | 62 | ||
| 3. Ihre Rangordnung | 63 | ||
| 4. Generalisierungsbedürftigkeit der konkreten Entscheidung. Fälle aus Rechtsprechung, Verwaltung, Gesetzgebung und Forschung | 63 | ||
| IV. Abweichende Ansichten | 67 | ||
| 1. Naturrecht, Relativismus | 67 | ||
| 2. Rechtsgefühl, Gewissen, Weltgewissen | 69 | ||
| Dritter Teil: Formen- und Prinzipienlehre des Rechts | 71 | ||
| § 8. Das positive Recht | 71 | ||
| I. Unentbehrlichkeit positiver Normen | 71 | ||
| II. Ihre Bedeutung | 71 | ||
| 1. Erkennbarkeit | 72 | ||
| 2. Anwendbarkeit | 73 | ||
| 3. Anpassungsfähigkeit | 73 | ||
| 4. Stetigkeit der Rechtsprechung | 73 | ||
| 5. Rechtsfrieden | 74 | ||
| III. Ihre nur relative Bedeutung | 74 | ||
| 1. in den einzelnen Rechtsmaterien | 75 | ||
| 2. Kulturelle Abhängigkeiten | 76 | ||
| IV. Zur Methodik der Rechtsvergleichung | 77 | ||
| § 9. Das lebende positive Recht. Macht und Zwang | 78 | ||
| I. Lebendes Recht als verwirklichtes konkretes Recht. Folgerungen | 78 | ||
| 1. Obrigkeitsstaat oder Volksstaat? | 78 | ||
| 2. Machtstaat oder Rechtsstaat? | 79 | ||
| II. Das Problem des Gewohnheitsrechts. Die Rechtsquellenlehre | 80 | ||
| III. Sonstige Rechtsbildung durch die sog. Macht der Tatsachen | 81 | ||
| 1. Besitz, Vermutungen, Zeitablauf. Ungerechter Ausschluß Berechtigter | 81 | ||
| 2. Rechtsbildung durch Revolution | 83 | ||
| IV. Gehört zum Wesen des Rechts Zwang? | 84 | ||
| § 10. Recht, Sitte, Moral | 85 | ||
| I. Konkreter Dreischichtenaufbau | 85 | ||
| II. Abstrakte Gegensätze | 85 | ||
| III. Gemeinsames und Verschiedenes | 86 | ||
| IV. Wertrang | 87 | ||
| 1. Abstrakte Nebenordnung | 87 | ||
| 2. Konkret gibt es vier Wertstufen | 87 | ||
| a) Moral | 88 | ||
| b) höhere Sitte (Gesittung) | 88 | ||
| c) Rechtsnormen | 89 | ||
| d) niedere Sitte (Anstand) | 89 | ||
| 3. Kulturelle Bedeutung | 89 | ||
| Ethisierung des Rechts. Humanität | 90 | ||
| § 11. Rechtsverwirklichung und Urteilsbildung | 90 | ||
| I. Zwei Kernprobleme. Die konkrete Gestaltungsnorm. Generalklauseln, Präjudizien, Ermessensentscheidungen | 90 | ||
| II. Wesen und Bedeutung der konkreten Gestaltungsnorm. Folgerungen für das Rechtsleben 1 bis 8 | 92 | ||
| III. Generalisierungsfähigkeit als Kunst des Urteilens | 96 | ||
| IV. Analyse der Überzeugungsbildung im Prozeß | 97 | ||
| § 12. Lücken und Widersprüche. Auslegung und Analogie | 98 | ||
| I. Einheit und Geschlossenheit der Rechtsordnung | 98 | ||
| 1. Echte Lücken sind nur Gesetzeslücken | 98 | ||
| 2. Sog. Rechtslücken. Widersprüche | 99 | ||
| II. Auslegung und Analogie. Arten und Fälle | 99 | ||
| III. Ihre Rechtsnatur und Behandlung | 100 | ||
| § 13. Unrichtiges Recht? | 102 | ||
| I. Voraussetzungen | 102 | ||
| 1. Konkrete Unrichtigkeit | 102 | ||
| 2. Unrichtige Gesetze. Beispiele | 103 | ||
| 3. Gründe: vermeidbares Unvermögen, die Gerechtigkeit zu verwirklichen | 105 | ||
| II. Rechtliche Behandlung | 106 | ||
| 1. Rechtsbehelfe | 106 | ||
| 2. Ungültigkeit und Unwirksamkeit der Akte | 107 | ||
| 3. Nur sehr beschränkt: Widerstandsrecht | 107 | ||
| § 14. Grundbegriffe des Rechts | 108 | ||
| I. Rechtsobjekt, Lebensinteresse, Rechtsgut, subjektives Recht (Anspruch), Rechtspflicht, Rechtsverhältnis, Rechtsinstitut (Typ), Rechtswerte (sozialer Wert, sozialer Beruf). Grundrechte im Völker- und im Verfassungsrecht | 109 | ||
| II. Rechtssubjekt. Natürliche und juristische Person | 111 | ||
| III. Rechtsverkehr. Vertragsbindung bei Interessenwandel? | 113 | ||
| Verschiedenheiten der Rechtsdisziplinen | 113 | ||
| IV. Volk, Staat, Nation (Kulturnation) | 115 | ||
| V. Die politische Partei | 116 | ||
| Vierter Teil: Kultur- und Wissenschaftslehre des Rechts | 118 | ||
| § 15. Die drei Seiten | 118 | ||
| I. Die drei obersten Prinzipien | 118 | ||
| II. Über die Dreigliederung der Probleme in den Geisteswissenschaften | 118 | ||
| III. Philosophiegeschichtliche Entwicklung. Wertphilosophie | 119 | ||
| Tafel II | 120 | ||
| § 16. Lebens- und Kultur philosophie | 123 | ||
| Aufgaben | 123 | ||
| I. Ausgang vom Leben. Stellungnahme zu den Neukantianern, zur Ontologie und Existenzphilosophie | 123 | ||
| II. Lebenswerte, Werteschaffen, Kultur | 126 | ||
| III. Ewigkeit, Gottheit. Normativer Pantheismus | 126 | ||
| IV. Andere Ansichten. Philosophiegeschichtliche Entwicklung | 128 | ||
| 1. Relativismus | 128 | ||
| 2. Utilismus, Pragmatismus | 129 | ||
| 3. Kulturtheorie | 129 | ||
| § 17. Aufbau und Gliederung der Kultur | 131 | ||
| I. Wesen | 131 | ||
| II. Gliederung | 132 | ||
| Tafel III | 132 | ||
| 1. Die vier Lebensfunktionen | 133 | ||
| 2. Die vier Kulturgebiete | 133 | ||
| 3. Die vier Kulturziele | 134 | ||
| III. Allgemeingültigkeit des Weltbildes | 137 | ||
| In ihm sind andere, aber einseitige Lebensbilder möglich. Erziehung zur Toleranz | 137 | ||
| IV. Kulturelle Typen der Entwicklung des Einzelmenschen und der Völker | 138 | ||
| Tafel IV | 139 | ||
| V. Einzelprobleme der Kulturtheorie | 139 | ||
| § 18. Das System der Wissenschaften | 141 | ||
| I. Ein System soll auch Erkenntniswerte vermitteln. Einteilungsgesichtspunkt: Grundgesetze und Erkenntnisobjekte | 141 | ||
| Tafel V | 142 | ||
| II. Aufbau der Wissenschaften | 143 | ||
| III. Gerechtigkeit und Wahrheit. Wesen. Arten der Wahrheit | 143 | ||
| IV. Juristische Nutzanwendung | 144 | ||
| 1. Schlüssigkeit. Wahrheitsurteil | 144 | ||
| 2. Gerechtigkeit als Maßstab | 145 | ||
| 3. Schönheit | 146 | ||
| V. Weitere Auswertung des Systemgedankens | 147 | ||
| 1. Forschung. Folgerungen | 147 | ||
| Vorrang des Gemeinwohls und des Völkerrechts | 147 | ||
| 2. Intuitive Forschung | 149 | ||
| § 19. Berufsethischer Abschluß | 150 | ||
| I. Konkretisierung der Rechtsidee, der Gerechtigkeit und des Gemeinwohls | 150 | ||
| II. Bausteine zum Aufbau der Kultur in Vorbereitung der Ewigkeit | 151 | ||
| III. Religion der beruflichen und allgemein sozialen Arbeit | 152 | ||
| IV. Vorbereitung des Weltfriedens der Völker | 152 | ||
| Literatur nebst kurzer Charakteristik | 154 | ||
| Register | 157 | ||
| Anhang: Zeittafel über Wilhelm Sauers Veröffentlichungen philosophischen, soziologischen, juristischen, ästhetischen und allgemein kulturellen Inhalts mit rechts- und sozialphilosophischen Tendenzen | 167 |
