Wettbewerb, Konzentration und wirtschaftliche Macht
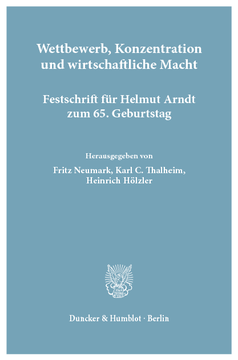
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Wettbewerb, Konzentration und wirtschaftliche Macht
Festschrift für Helmut Arndt
Editors: Neumark, Fritz | Thalheim, Karl C. | Hölzler, Heinrich
(1976)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Zueignung | 5 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 9 | ||
| Walter Adams: Antitrust, Laissez-faire, and Economic Power | 11 | ||
| Gilles Y. Bertin: Capacité Défensive, Dispersion et Pouvoir des Grandes Sociétés | 19 | ||
| I. Les menaces | 20 | ||
| II. | 23 | ||
| III. | 27 | ||
| IV. | 30 | ||
| Gert von Eynern: Tarifautonomie trotz Mitbestimmung? | 37 | ||
| I. Das Problem | 37 | ||
| II. Zur Legitimität einer Ubermacht der Gewerkschaften | 39 | ||
| III. Edite und unechte Paritäten bei der Mitbestimmung | 40 | ||
| IV. Tarifparteien: Autonomie gegenüber dem Staat | 42 | ||
| V. Gegner-Unabhängigkeit der Tarifparteien | 45 | ||
| VI. Das Schweigen des Grundgesetzes | 50 | ||
| Eberhard Günther: Multinationale Unternehmen und Wettbewerb | 55 | ||
| Vorbemerkungen | 55 | ||
| I. Wettbewerbspolitische Beurteilung | 56 | ||
| II. Wettbewerbspolitische Maßnahmen | 65 | ||
| Heinrich Hölzler und Wolfgang Winkler: Wirtschaftliche Macht als Störfaktor von Wettbewerbsprozessen | 71 | ||
| Vorbemerkung | 71 | ||
| I. Der störungsfreie Ablauf von Wettbewerbsprozessen | 72 | ||
| II. Arten und Ursachen der Entstehung und des Einsatzes wirtschaftlicher Macht | 75 | ||
| III. Ansatzpunkte zur Kontrolle von Marktmacht | 89 | ||
| J. van Hoorn Jr.: Fördert das Steuerrecht die wirtschaftliche Konzentration? Ein rechtsvergleichender Beitrag | 95 | ||
| I. Einführung und Begriffsbestimmungen | 95 | ||
| II. Fusionen | 100 | ||
| III. Beteiligungen | 103 | ||
| IV. Zusammenfassung | 109 | ||
| Rexmut Jochimsen: Zum Machtaspekt in der Berufsbildungsdebatte | 111 | ||
| 1. Macht, Schichtung und Chancengleichheit im Bildungswesen | 111 | ||
| 2. Rahmenbedingungen der beruflichen Bildung | 113 | ||
| 2.1 Entwicklung des „Marktes" für berufliche Bildung in der Bundesrepublik Deutschland | 113 | ||
| 2.2 Veränderungen gesellschaftlidier Rahmenbedingungen als Ausgangspunkt einer Reform der beruflichen Bildung | 114 | ||
| 3. Reformpolitik und Machtfragen in der beruflichen Bildung | 117 | ||
| 3.1 Grundfragen einer Reform der beruflichen Bildung | 117 | ||
| 3.2 Zur Reformdiskussion der beruflichen Bildung | 118 | ||
| 3.3 Quantität und Qualität beruflicher Ausbildungsplätze als Erfolgskriterien der Berufsbildungsreform | 120 | ||
| 4. Kritische Anmerkungen zum Problemkreis Macht und berufliche Bildung | 124 | ||
| Walter Adolf Jöhr: Die kollektive Selbstschädigung durch Verfolgung des eigenen Vorteils erörtert aufgrund der „Tragik der Allmende", des „Schwarzfahrer-Problems" und des „Dilemmas der Untersuchungsgefangenen" | 127 | ||
| I. Drei Standardfälle aus der sozialwissenschaftlichen Literatur | 128 | ||
| 1. Die „Tragik der Allmende" | 128 | ||
| 2. Das „Schwarzfahrer-Problem" | 129 | ||
| 3. Das „Dilemma der Untersuchungsgefangenen" | 131 | ||
| 4. Gemeinsame Merkmale der drei Standardfälle | 133 | ||
| II. Modifikation der Standardfälle durch Einführung der Beeinflußbarkeit der Schicksalsgefährten | 134 | ||
| 1. Modifikation des Dilemmas der Untersuchungsgefangenen | 135 | ||
| 2. Modifikation des Schwarzfahrer-Problems | 136 | ||
| 3. Modifikation des umweit-ökonomischen Falles | 138 | ||
| a) Der Ansatz von Bruno Frey | 138 | ||
| b) Das Verhalten innerhalb einer großen Gruppe | 139 | ||
| c) Das Verhalten innerhalb einer kleinen Gruppe | 140 | ||
| d) Die Schlußfolgerungen von Bruno Frey | 141 | ||
| III. Die Tragweite der Lehre von der kollektiven Selbstschädigung | 142 | ||
| 1. Umweltökonomie | 142 | ||
| 2. Kriegswirtschaft und verwandte Situationen | 143 | ||
| 3. Verhalten gegenüber dem Staat | 144 | ||
| 4. Verhalten im Depressionsfall | 145 | ||
| 5. Verhalten im monetären Bereich | 146 | ||
| 6. Verhalten von Angehörigen einer kleinen Gruppe | 146 | ||
| IV. Versuch einer systematischen Gliederung der Möglichkeiten kollektiver Selbstschädigung | 147 | ||
| 1. Gliederung in zeitlicher Hinsicht | 147 | ||
| 2. Gliederung nach der Zahl der beteiligten Subjekte | 148 | ||
| 3. Gliederung nach der Stellung der Subjekte | 148 | ||
| 4. Gliederung nach der Art der Beziehung zwischen den Subjekten | 149 | ||
| 5. Gliederung nach der Art des vorausgesetzten Handelns der andern | 149 | ||
| 6. Gliederung nach der Art der Einstellung zu den anderen beteiligten Subjekten | 149 | ||
| 7. Gliederung nach der Art der Schädigung | 150 | ||
| 8. Gliederung nach den Voraussetzungen der Schädigungsmöglichkeit | 150 | ||
| V. Schlußfolgerungen | 151 | ||
| 1. Konfrontation der Ergebnisse mit der Lehre von der Förderung des Gemeinwohls durch die Verfolgung des Privatinteresses | 151 | ||
| 2. Bekämpfung der kollektiven Selbstschädigung durch Appell an die Moral? | 154 | ||
| 3. Bekämpfung durch staatliche Maßnahmen | 157 | ||
| H. W. de Jong: Power, Profits and Wastage An Economic Analysis of the European Pharmaceutical Industry | 161 | ||
| 1. Introduction | 161 | ||
| 2. Industry structure | 162 | ||
| a) Internationalization | 162 | ||
| b) Concentration | 165 | ||
| c) Entry Barriers | 168 | ||
| d) Research and Development, Patents, and Product Differentiations | 170 | ||
| 3. The Nature of Costs, Competition and Prices | 174 | ||
| a) The Cost structure and Pricing behaviour | 174 | ||
| b) Empirical evidence | 175 | ||
| c) Profits and Risks | 179 | ||
| 4. Public Policy: some final remarks | 183 | ||
| Hans Otto Lenel: Zur Problematik der Ermittlung optimaler Betriebsgrößen und ihrer Verwendung | 185 | ||
| I. Vorbemerkungen | 185 | ||
| II. Zu den Verfahren und ihrer Problematik | 186 | ||
| ΙII. Zu den Ergebnissen neuerer Schätzungen von Optimalgrößen | 199 | ||
| IV. Lehren für die Wettbewerbspölitik | 210 | ||
| Gardiner C. Means: Administrative Inflation and Public Policy | 213 | ||
| I. The Non-classical Behavior of Industrial Prices | 213 | ||
| II. The Implication for Policy | 216 | ||
| Günter Ollenburg: Zur Änderung von Marktstrukturen im Wirtschaftsproze | 219 | ||
| Einführung | 219 | ||
| I. Notwendigkeit und Grenzen des Marktkonzepts | 219 | ||
| II. Differentialgewinne, Lerngewinne und Marktkonsistenz | 224 | ||
| IIΙ. Dilëmma-Thesen und Wettbewerbsprozeß | 230 | ||
| IV. Einige Konsequenzen | 239 | ||
| François Perroux: Die tranenationaleii Einheiten (T. N. E.) und die Erneuerung der Theorie des allgemeinen (inneren und äußeren) Gleichgewichts | 241 | ||
| I. Grundlegung | 241 | ||
| II. Die Τ. Ν. E. als „aktive" Einheit | 246 | ||
| III. Die Τ. Ν. E. als komplexe Einheit, ihre Verflechtungen — Die Finanzgruppen und die strukturelle Einwirkung | 248 | ||
| 1. Die T. Ν. E. als komplexe Einheit | 248 | ||
| 2. Die Verflechtungen der Τ. Ν. E. | 249 | ||
| 3. Die Finanzgruppen | 250 | ||
| 4. Die topologischen Darstellungen | 250 | ||
| 5. Die Macht des Kapitals | 254 | ||
| 6. Struktureffekte | 256 | ||
| IV. Die Unbestimmtheit im Funktionieren des Systems und dessen Unbeständigkeit | 257 | ||
| 1. Die Unbestimmtheit im Funktionieren des Systems | 257 | ||
| 2. Die Unbeständigkeit des Systems | 258 | ||
| V. Reformprojekte und Macht des Kapitals | 259 | ||
| 1. Erneuerung der Theorie des allgemeinen ökonomischen Gleichgewichts und T. Ν. E. | 259 | ||
| 2. Macht und Gegenmacht | 260 | ||
| Arno Sölter: Die besonderen Wettbewerbsbedingungen homogener und heterogener Güter | 263 | ||
| Α. Homogene und heterogene Güter | 264 | ||
| I. Homogene Güter | 265 | ||
| II. Heterogene Güter | 266 | ||
| III. Quasihomogene (pseudoheterogene) Güter | 269 | ||
| IV. Definitionen | 269 | ||
| B. Wettbewerbliche Spezifika homogener und heterogener Güter | 270 | ||
| I. Wettbewerbliche Spezifika homogener Güter | 270 | ||
| II. Wettbewerbliche Spezifika heterogener Güter | 271 | ||
| 1. Unvergleichbarmachung (Individualisierung) | 271 | ||
| 2. Aktive Marktgestaltung | 272 | ||
| III. Mengenparameter vor Preisparameter | 273 | ||
| C. Der Wettbewerbsprozeß bei heterogenen Gütern | 274 | ||
| I. „Produktwettbewerb" als Hauptparameter | 274 | ||
| II. Wettbewerbsintensität bei heterogenen Gütern | 275 | ||
| ΙII. Heterogenisierung im Konjunkturverlauf | 278 | ||
| IV. Heterogenisierung als Instrument der Beschäftigungspolitik | 279 | ||
| V. Heterogenisierung dient der Erhaltung einer gesunden Strukturmischung | 280 | ||
| VI. Wettbewerbstheorie: Vom „monopolistischen" zum Heterogenisierungswettbewerb | 281 | ||
| D. Der Wettbewerbsprozeß bei homogenen Gütern. Preiswettbewerbsempfindlichkeit als Charakteristikum | 284 | ||
| I. Tendenz zu konstanter Preisderoute | 285 | ||
| II. Preiswettbewerbsverstärkende Tatbestände | 288 | ||
| 1. Produktkonstanz | 288 | ||
| 2. Hohe Kapitalintensität | 289 | ||
| 3. Kostendruck | 289 | ||
| 4. Schwierigkeiten bei geringer Wertschöpfungsspanne | 289 | ||
| 5. Frachtintensität | 289 | ||
| 6. „Abgeleiteter Bedarf" | 289 | ||
| 7. Saisonabhängigkeit | 290 | ||
| 8. Volumengeschäft | 290 | ||
| 9. Heterogene Betriebsgrößenstruktur | 290 | ||
| 10. Stufenwettbewerb | 290 | ||
| 11. Hohe Konjunkturreagibilität | 291 | ||
| 12. Handikap bei der Weitergabe von Kostensteigerungen | 291 | ||
| 13. Diskriminierendes Kartellrecht | 292 | ||
| III. Volkswirtschaftliche Bedeutung der Homogenen | 292 | ||
| IV. Autonome Maßnahmen der „Homogenen" zur Sicherung ihrer Wettbewerbsposition | 293 | ||
| 1. Die Entscheidung des Unternehmers | 293 | ||
| 2. Negative Maßnahmen („Nichtleistungswettbewerb") der „Homogenen" im f }ungeordneten" ( Wettbewerb | 295 | ||
| 3. Individuelle positive Maßnahmen | 296 | ||
| a) Umsatzausweitung | 296 | ||
| b) Individuelle Preisdisziplin | 297 | ||
| c) Heterogenisierung | 297 | ||
| d) Vertikalisierung | 297 | ||
| e) Autonome Spezialisierung | 297 | ||
| f) Diversifikation | 297 | ||
| g) Oligopolisierung | 298 | ||
| aa) Optimale Marktform | 298 | ||
| bb) Oligopolisierungswege | 300 | ||
| V. Kooperative Maßnahmen „Homogener" zur Ordnung des Wettbewerbs | 300 | ||
| 1. Das Marktinformationsverfahren (MIV) | 301 | ||
| 2. Kooperative Ordnungsmaßnahmen | 301 | ||
| a) Konditionen- und Rabattvereinbarungen | 301 | ||
| b) Nichtdiskriminierungsverträge (ND-Verträge) | 302 | ||
| c) Normungs- und Typisierungsvereinbarungen | 302 | ||
| d) Gruppenkooperation | 302 | ||
| e) Preis- und Quotenkartelle | 303 | ||
| f) Verkaufsgemeinschaften und Syndikate | 303 | ||
| g) Strukturkrisenkartelle (§ 4 GWB) | 303 | ||
| h) Investitionsabsprachen | 303 | ||
| 3. Ordnungsmaßnahmen der „Homogenen" und das Abnehmerinteresse | 303 | ||
| 4. Wettbewerb — trotz Wettbewerbsordnung für „Homogene" | 304 | ||
| VI. Wettbewerbspolitische Beurteilung der Kooperationserfordernisse bei homogenen Gütern | 306 | ||
| 1. Wettbewerbspolitischer Vergleich USA / Bundesrepublik Deutschland | 306 | ||
| 2. Hier strenges Kartellverbot — dort weitgehende Ausnahmen | 309 | ||
| a) Verkehr | 310 | ||
| b) Versicherungen | 310 | ||
| c) Kreditgewerbe | 310 | ||
| d) Landwirtschaft | 310 | ||
| e) Energie | 310 | ||
| 3. Exkurs: Ordnungsprobleme homogener Weltrohstoffe | 311 | ||
| 4. Überprüfung der Grundkonzeption des GWB | 313 | ||
| Karl C. Thalheim: Konzentration und wirtschaftliche Macht in einer sozialistischen Ordnung Untersucht am Beispiel der DDR | 317 | ||
| I. Die Eignung der DDR als Gegenstand der Analyse | 317 | ||
| II. Die Bewertung der Konzentration in der marxistisch-leninistischen Politökonomie | 319 | ||
| III. Konzentration des Eigentums an den Produktionsmitteln in der Hand des Staates | 320 | ||
| IV. Der Staat als Arbeitgeber und die Gewerkschaften | 322 | ||
| V. Das sozialistische Eigentum der Produktionsgenossenschaften | 327 | ||
| VI. Die Vereinheitlichung der beiden Formen des sozialistischen Eigentums | 328 | ||
| VII. Die Bedeutung von Planung und Lenkung für Macht und Konzentration | 330 | ||
| VIII. Der Einfluß des Außenhandels- und Devisenmonopols | 334 | ||
| IX. Der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe als Machtinstrument | 337 | ||
| Günter Zenk: Aspekte der ökonomischen Konzentration in den Ländern der Dritten Welt | 345 | ||
| 1. Vorbemerkungen | 345 | ||
| 2. Konzentrationsprozeß und Wirtschaftsstruktur | 346 | ||
| 3. Stand und Entwicklung der Konzentration | 348 | ||
| a) Verarbeitender Sektor | 348 | ||
| b) Landwirtschaft | 351 | ||
| 4. Einfluß von Nachfragestrukturen und Produktionsbedingungen auf die ökonomische Konzentration | 353 | ||
| 5. Effekte der Konzentration | 357 | ||
| a) Stabilität monopolistischer Strukturen | 357 | ||
| b) Grenzen des internen Expansionsprozesses | 358 | ||
| 6. Konzentration und Integrationsansätze in Entwicklungsländern | 360 | ||
| 7. Auswirkungen der internationalen Konzentration auf die Entwicklungsländer | 361 | ||
| Ronald Müller: Towards a Political Economy of Multinational Corporations and Nation-States | 369 | ||
| I. Introduction | 369 | ||
| II. The Uniqueness of MNCs and their Implications on Distribution Impacts: Focus on Home and Host Nations | 371 | ||
| III. Transformation Processes in Home Nations: Focus on U. S. and the Stability Issue | 377 | ||
| A. Globalization and Concentration | 377 | ||
| B. The Post Market Economy | 379 | ||
| C. The Vicious Circles of Macroeconomic Policy | 380 | ||
| D. The Loss of Another Automatic Stabilizing Influence: Business Cycles | 382 | ||
| IV. MNCs and new Interface Mechanisms with LDCs: The new Era of Bargaining Power | 383 | ||
| V. Future Interface Mechanisms between Multinational Corporations and Developed Nations: Focus, USA 1985 | 387 | ||
| Bibliographie Helmut Arndt | 395 | ||
| I. Bücher | 395 | ||
| II. Herausgeber | 395 | ||
| III. Aufsätze und Abhandlungen | 396 | ||
| IV. Beiträge in Festschriften | 399 | ||
| V. Sonstige Veröffentlichungen | 400 |
