Theorie der Willensbildung in Unternehmerverbänden
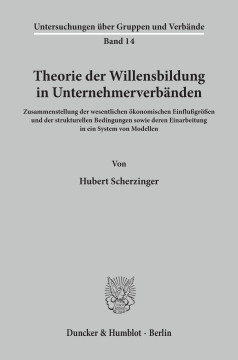
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Theorie der Willensbildung in Unternehmerverbänden
Zusammenstellung der wesentlichen ökonomischen Einflußgrößen und der strukturellen Bedingungen sowie deren Einarbeitung in ein System von Modellen
Untersuchungen über Gruppen und Verbände, Vol. 14
(1978)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Inhaltsverzeichnis | 5 | ||
| Liste der Abbildungen | 7 | ||
| Α. Einleitung: Problemstellung und Vorgehensweise | 9 | ||
| B. Hauptteil | 15 | ||
| 1. Rahmenbedingungen für ein Modell | 15 | ||
| 1.1. Die Interessen in Unternehmerverbänden | 15 | ||
| 1.1.1. Verhältnis der Mitglieder- zu den Verbandsinteressen | 15 | ||
| 1.1.2. Verbandsmitglieder und Charakteristika ihrer Interessen | 17 | ||
| 1.1.3. Interessen der Mitglieder von Verbandsgremien | 22 | ||
| 1.1.4. Die Geschäftsführungsinteressen | 26 | ||
| 1.1.5. Kollektiv- und Individualgüter als Objekte der Mitgliederinteressen | 30 | ||
| 1.1.6. Kosten bei der Interessen Verfolgung | 38 | ||
| 1.2. Strukturelle Bedingungen des Willensbildungsprozesses | 48 | ||
| 1.2.1. Vorbemerkungen zu diesem Abschnitt | 48 | ||
| 1.2.2. Mitgliederanzahl und -Unterschiedlichkeit | 49 | ||
| 1.2.3. Organisationsmöglichkeiten | 51 | ||
| 1.2.4. Information in Unternehmerverbänden | 55 | ||
| 1.2.5. Informationsverarbeitungsmöglichkeiten | 64 | ||
| 1.2.6. Budgetierung in Verbänden | 66 | ||
| 1.2.7. Verbandsvermögen | 73 | ||
| 1.2.8. Äußere Bedingungen des Willensbildungsprozesses | 79 | ||
| 1.2.9. Hierarchie der Fälle kollektiver Willensbildung | 83 | ||
| 1.3. Der Ablauf des Willensbildungsprozesses | 84 | ||
| 1.3.1. Steuerung des Willensbildungsprozesses | 84 | ||
| 1.3.2. Vorschlagswesen | 88 | ||
| 1.3.3. Kollektive Beratung und Verhandlung | 96 | ||
| 1.3.4. Kollektive Willensfestlegung | 110 | ||
| 1.3.5. Sanktionen der Verbände | 114 | ||
| 2. Individualkalkiile im Verband | 117 | ||
| 2.1. Umfang der Problematik bei der Festlegung von Präferenzordnungen in dieser Arbeit | 117 | ||
| 2.2. Die theoretischen Aspekte der verwendeten Nutzenfunktionen | 119 | ||
| 2.3. Die grundsätzliche Form der Nutzenfunktionen und Präferenzordnungen | 122 | ||
| 2.4. Präferenzordnungen für die wichtigsten institutionellen Gegebenheiten beim Willensbildungsprozeß | 144 | ||
| 2.4.1. Nutzenfunktionen bei Verbandsvermögen | 144 | ||
| 2.4.2. Nutzenfunktionen bei Personalwählen | 148 | ||
| 2.4.3. Die Nutzenfunktion bei Satzungsänderung | 150 | ||
| 2.4.4. Verbandseintritt und Verbandsgründung in Nutzenfunktionen | 151 | ||
| 3. Willensbildungsmodelle | 152 | ||
| 3.1. Modellanforderungen und daraus notwendige Modelltypen | 152 | ||
| 3.1.1. Grundsätzliche Sicht | 152 | ||
| 3.1.2. Zu erfassende funktionale Zusammenhänge | 153 | ||
| 3.1.3. Anforderungen an das Willensbildungsverfahren und sein Grundkonzept | 154 | ||
| 3.1.4. Manuelle Durchführung einer Simulationsrechnung | 165 | ||
| 3.2. Modellkonstruktionen | 173 | ||
| 3.2.1. Einfachstes Modell: drei Individualgütersachpunkte und einfache Kostensummenumlage bei fehlender Verbandsaustrittsmöglichkeit | 173 | ||
| 3.2.2. Modell mit Austrittsmöglichkeit | 175 | ||
| 3.2.3. Ausbeutung durch kombiniertes Angebot von Kollektiv- und Individualgütern bei Austrittsmöglichkeit | 179 | ||
| 3.2.4. Einfluß der Beschaffungsverfahren auf die Willensbildung | 193 | ||
| 3.2.5. Einfluß der Budgetierungsverfahren auf die Willensbildung | 199 | ||
| 3.2.6. Einfluß durch das Verbandsvermögen | 210 | ||
| 3.2.7. Einfluß der Gremiengliederung auf das Willensbildungsergebnis | 242 | ||
| 3.2.8. Einfluß der Mitgliederunterschiedlichkeit | 279 | ||
| C. Schluß: Zusammenfassung der Lösungen und Übersicht der Lücken | 290 | ||
| Anhang | 294 | ||
| Literaturverzeichnis | 299 |
