Die natürliche Wirtschaftsordnung der wirtschaftlichen Arbeitsdreiteilung
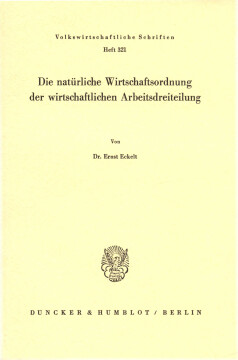
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Die natürliche Wirtschaftsordnung der wirtschaftlichen Arbeitsdreiteilung
Volkswirtschaftliche Schriften, Vol. 321
(1982)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 7 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 11 | ||
| Erster Teil: Methoden der Erkenntnis des wirtschaftlichen Geschehens | 19 | ||
| A. Entwicklungsdenken und Ordnungsdenken | 19 | ||
| I. Walter Euckens Lehre von den zwei Grundformen der Wirtschaftsordnung: Zentralverwaltungswirtschaft und Verkehrswirtschaft | 19 | ||
| II. Die Euckenschen Thesen im einzelnen | 22 | ||
| III. Weiterentwicklung der Euckenschen Lehren durch Erich Schneider | 24 | ||
| B. Fortentwicklung der historisch-morphologischen zu einer relativitätstheoretisch-anthropologischen Methode | 26 | ||
| I. Unzulänglichkeit der historisch-morphologischen Methode | 26 | ||
| 1. Die Wirtschaft außereuropäischer Staaten | 27 | ||
| 1.1. USA | 27 | ||
| 1.2. Japan | 28 | ||
| 1.3. China | 30 | ||
| 2. Die Wirtschaft Deutschlands | 34 | ||
| 2.1. Bis zur Teilung | 34 | ||
| 2.2. Nach der Teilung | 36 | ||
| 2.2.1. DDR | 36 | ||
| 2.2.2. Bundesrepublik | 38 | ||
| 3. Wirtschaftsordnung, Wirtschaftsverfassung, Wirtschaftssystem, natürliche Wirtschaftsordnung | 44 | ||
| II. Relativitätstheoretisch-anthropologische Methode | 46 | ||
| 1. Die Masse-Energie-Gleichung E = m x c2 | 47 | ||
| 2. Die große naturwissenschaftliche Revolution des 20. Jahrhunderts und ihr Einfluß auf die Wirtschaftswissenschaften | 48 | ||
| 2.1. Potentielle und kinetische wirtschaftliche Energie (Geld- und Sachkapital) | 48 | ||
| 2.2. Veränderung des Objekt-Subjekt-Verhältnisses und des Kausalitätsbegriffs – Vier Bezugssysteme des wirtschaftlichen Geschehens | 50 | ||
| 2.3. Die Veränderung des Raum-Zeit-Verhältnisses durch die Masse-Energie-Gleichung – Das Raum-Zeit-Kontinuum des wirtschaftlichen Geschehens und seine Darstellung durch die doppelte Buchführung – Die Wirtschaftsrechnung als Mittel der Erkenntnis des wirtschaftlichen Geschehens und der Wirtschaftsordnung | 53 | ||
| Zweiter Teil: Die vier Bezugssysteme des wirtschaftlichen Geschehens | 56 | ||
| 1. Relativität der Knappheit | 56 | ||
| 2. Die Arbeitsteilung als das „zentrale Phänomen“ der Wirtschaft | 57 | ||
| 3. Technische und wirtschaftliche Arbeitsteilung – Die drei wirtschaftlichen Leistungen: des Unternehmers, des Finanziers und des Arbeitnehmers und ihre Meßwerte: der Preis, der Zins und der Lohn | 57 | ||
| 4. Interdependenz der vier Bezugssysteme | 59 | ||
| A. Das Erste (interne) Bezugssystem: Das Unternehmen für sich | 60 | ||
| I. Die Schlüsselposition des Unternehmens – Sein Fehlen in der Zentralverwaltungswirtschaft – Kombinate und Konzerne | 60 | ||
| II. Das Unternehmen im System der Wirtschaftswissenschaften | 63 | ||
| 1. Betriebswirtschaftlicher und volkswirtschaftlicher Unternehmensbegriff | 63 | ||
| 2. Der volkswirtschaftliche Unternehmensbegriff nach Erich Schneider | 64 | ||
| 2.1. Die drei Produktionsfaktoren (Boden, Arbeit, Kapital) | 65 | ||
| 2.2. „Das eigentlich Wirtschaftliche“ | 66 | ||
| III. Erschließung von Erkenntnissen der Großen Naturwissenschaftlichen Revolution für die Wirtschaftswissenschaften | 67 | ||
| 1. Materie als geballte Energie – Das Grundgesetz des Lebens: der permanente Umsatz von Kraft und Stoff | 67 | ||
| 2. Das allgemeine Grundgesetz der Wirtschaft von der permanenten Konzentration wirtschaftlicher Energie in Sachgütern und dem Rückgewinn aus ihnen | 67 | ||
| 3. Die Meßbarkeit der wirtschaftlichen Energie durch die Wirtschaftsrechnung | 69 | ||
| 4. Die Kapital-Arbeit-Gleichung: Kapital als der einzige Wirtschaftsfaktor – Kapital als die meßbare wirtschaftliche Energie | 70 | ||
| IV. Die Wirtschaftsrechnung als Mittel zur Erkenntnis der Wirtschaftsordnung | 70 | ||
| 1. Die unmittelbare Erfassung des wirtschaftlichen Geschehens durch die Wirtschaftsrechnung | 70 | ||
| 2. Faktische und gedachte Buchführung und Bilanz | 71 | ||
| 3. Formelles und materielles Bilanzrecht, dargestellt am Vorgang der Gründung einer Aktiengesellschaft | 71 | ||
| 3.1. Die Begriffe Vermögen und Kapital | 72 | ||
| 3.2. Der Kapitalbegriff als Leistungsbegriff – Der Gründungsvorgang als ein Vorgang des Wirtschaftsrechts | 73 | ||
| 3.3. „Das eigentlich Wirtschaftliche“ des Gründungsvorgangs: Entstehung eines Volumens wirtschaftlicher Energie | 74 | ||
| 4. Die Bedeutung der Wirtschaftsrechnung für alle Unternehmen: Darstellung der Träger und Quellen der wirtschaftlichen Energie (des Kapitals) – Grundschema einer gedachten Gründungsbilanz | 75 | ||
| 5. Die Bedeutung der doppelten Buchführung für die Erkenntnis des „eigentlich Wirtschaftlichen“ (der natürlichen Wirtschaftsordnung) – Modell einer Wirtschaftsrechnung | 75 | ||
| V. Die kapitalistische Natur des wirtschaftlichen Geschehens im Unternehmen als „das eigentlich Wirtschaftliche“ | 80 | ||
| 1. Die drei wirtschaftlichen Leistungen des Unternehmers, des Finanziers und des Arbeitnehmers | 81 | ||
| 2. Kapitalistische Natur aller drei wirtschaftlichen Leistungen | 82 | ||
| 3. Die drei Arten wirtschaftlicher Leistungen | 83 | ||
| 4. Maßstab und Meßwerte der drei wirtschaftlichen Leistungen | 83 | ||
| 5. Die drei wirtschaftlichen Leistungen im einzelnen | 83 | ||
| 6. Insbesondere die wirtschaftliche Leistung des Unternehmers | 88 | ||
| 7. Die wirtschaftsrechtliche Position des Unternehmers | 90 | ||
| 7.1. in der Aktiengesellschaft (autonome und heteronome Unternehmer) | 90 | ||
| 7.2. in allen Unternehmen (Kapitalgewalt und Eigentum) | 92 | ||
| 7.3. Grundform und Abwandlungen – Die Manager – „Riesen“ und „Zwerge“ – Doppelfunktion der Anteilseigner | 93 | ||
| 8. Gemeinschaftsunternehmen in Zentralverwaltungswirtschaften | 95 | ||
| 8.1. in China | 95 | ||
| 8.2. in Ungarn | 97 | ||
| 8.3. nicht in Jugoslawien | 98 | ||
| 9. Das spezielle Grundgesetz der Wirtschaft von der Erhaltung und Mehrung wirtschaftlicher Energie (des Kapitals) | 99 | ||
| 10. Der Unternehmer als Gestalter des wirtschaftlichen Geschehens in den vier Bezugssystemen | 100 | ||
| B. Das Zweite (externe) Bezugssystem: Das Unternehmen in seinen Beziehungen zu anderen Unternehmen | 102 | ||
| 1. Der Erwerbsvorgang | 103 | ||
| 2. Der Markt | 107 | ||
| 2.1. Definition des Marktbegriffs | 107 | ||
| 2.2. Das Marktgeschehen als eine Kette von Erwerbsvorgängen | 108 | ||
| 2.2.1. Konsum und Investition | 109 | ||
| 2.2.2. Wettbewerb | 109 | ||
| 3. Wirtschaftliche und politische Freiheit | 110 | ||
| 3.1. Inkongruenz von wirtschaftlicher und politischer Freiheit | 110 | ||
| 3.2. Die „sogenannte Demokratisierung“ der Wirtschaft | 110 | ||
| C. Das Dritte (nationale) Bezugssystem des Unternehmens zum Staat | 113 | ||
| I. Die Geldschöpfung als Aufgabe des Staates beim Erwerbsvorgang | 113 | ||
| 1. Autonomie der Deutschen Bundesbank im autonomen Bankensystem | 113 | ||
| 2. Der Vorgang der Geldschöpfung | 114 | ||
| 2.1. Das Wesen des Geldes | 115 | ||
| 2.1.1. Goldwährung – Gold-Devisen-Währung – Sonderziehungsrechte (SZR) – Der Dollar als Leitwährung | 115 | ||
| 2.1.2. Loslösung des Dollars vom Gold – Die SZR in einem System abstrakter Währungen – Statt Gold Standardkorb von 5 Währungen – Entstehung des Geldes aus Buchungsvorgängen | 116 | ||
| 2.1.3. Geld als eine von den Rechenwerken des Bankensystems gelieferte Recheneinheit | 121 | ||
| 2.2. Das Geld als Mittel der wirtschaftsrechnerischen Darstellung des Erwerbsvorgangs – Der Vorgang der doppelten Buchführung als Kapital-Gewinn- und Verlust-Vorgang | 122 | ||
| 2.3. Zwei Verwendungsarten des Geldes: als konstante Recheneinheit (Zahlungsmittel) und als variable Recheneinheit (Bewertungsmittel) | 124 | ||
| 2.3.1. Ineinandergreifen der beiden Arten von Recheneinheiten | 126 | ||
| 2.3.2. Die variable Recheneinheit als Voraussetzung der konstanten (der Bemessung des Geldvolumens) | 127 | ||
| 3. Der Geldbegriff | 129 | ||
| 3.1. Geld als Maßstab des Kapitals (der wirtschaftlichen Energie) | 129 | ||
| 3.2. Auseinandersetzung mit der Veitschen „Realen Theorie des Geldes“ | 130 | ||
| 3.3. Einheitlicher Kapital-Geld-Begriff | 135 | ||
| II. Folgerungen aus dem einheitlichen Kapital-Geld-Begriff für die Geldschöpfung und das wirtschaftliche Geschehen in den Unternehmen | 136 | ||
| 1. Das „eigentlich Wirtschaftliche“ des Gegenstandes monetärer Maßnahmen: das Kapital, als wirtschaftliche Energie begriffen | 136 | ||
| 1.1. Schöpfung eines Geldvolumens als wirtschaftsrechnerischer Ausdruck der Entstehung eines Volumens wirtschaftlicher Energie | 136 | ||
| 1.2. Die Worte Geld und Kapital im Sprachgebrauch | 137 | ||
| 1.3. Die Worte Geld und Kapital in der herrschenden Lehre | 138 | ||
| 1.4. „Monetaristen“ und „Keynesianer“ | 139 | ||
| 2. Niederschlag des speziellen Grundgesetzes der Wirtschaft in den einzeln- und gesamtwirtschaftlichen Rechenwerken (Gewinn und Wachstum) | 140 | ||
| 2.1. Das Wesen des Wachstums | 140 | ||
| 2.2. Das Wachstum im „magischen Viereck“ der wirtschaftspolitischen Zielvorgaben | 142 | ||
| 2.2.1. Wachstum und Preisniveau | 142 | ||
| 2.2.1.1. Die „Teuerung“ als Ausgleich einer Geldmeßwertdifferenz (Spannungsrate) – Diese und eine Überschußrate als Teile der Wachstumsrate – Indexautomatik | 144 | ||
| 2.2.1.2. Geldmeßwertdifferenz und Inflation | 145 | ||
| 2.2.1.3. Indexierung aller Meßwerte | 147 | ||
| 2.2.1.3.1. Indexierung des Lohnes | 148 | ||
| 2.2.1.3.2. Indexierung des Preises | 148 | ||
| 2.2.1.3.3. Indexierung des Zinses | 149 | ||
| 2.2.1.4. Geldmeßwertdifferenz und Geldmeßwert-Diskrepanz – Optimaler Satz der Geldmeßwertdifferenz (einer „unvermeidlichen Preissteigerungsrate“) | 155 | ||
| 2.2.2. Wachstum und Beschäftigungsgrad | 156 | ||
| 2.2.3. Wachstum und außenwirtschaftliches Gleichgewicht | 157 | ||
| 2.3. Das Wachstum als die primäre Zielvorgabe des „magischen Vierecks“ – Wachstumsbedingtheit der drei anderen Zielvorgaben, insbesondere des Preisniveaus und des Beschäftigungsstandes (Vollbeschäftigung und Gastarbeiter) | 160 | ||
| 2.4. Folgerungen aus dem Wachstumsziel für die Geldschöpfung und das wirtschaftliche Geschehen in den Unternehmen | 162 | ||
| 2.4.1. Gleichung von Geldvolumen und Potential wirtschaftlicher Energie | 163 | ||
| 2.4.2. Das Wachstumsziel als monetäre Aufgabe der Zentralnotenbank | 163 | ||
| 2.4.3. Das Instrumentarium der Zentralnotenbank | 164 | ||
| 2.4.4. Die außermonetären Maßnahmen der Gesetzgebung und Verwaltung | 164 | ||
| 2.4.5. Die Geldpolitik als Teil der wachstumsorientierten Wirtschaftspolitik | 166 | ||
| 2.4.6. Einzelwirtschaftlicher Gewinn und gesamtwirtschaftliches Wachstum | 167 | ||
| III. Das Verhältnis der Gesellschafts- zur Wirtschaftsordnung (gesellschafts- und wirtschaftsordnende Maßnahmen des Staates) | 167 | ||
| 1. Der Staat als Gestalter des wirtschaftlichen Geschehens in den Unternehmen | 167 | ||
| 2. Der Staat als Förderer des wirtschaftlichen Geschehens in den Unternehmen | 168 | ||
| 2.1. Allgemein gesellschaftsordnende und speziell wirtschaftsordnende Maßnahmen | 168 | ||
| 2.1.1. Allgemein gesellschaftsordnende Maßnahmen | 168 | ||
| 2.1.2. Speziell wirtschaftsordnende Maßnahmen | 169 | ||
| 2.2. Maßnahmen von Gesetzgebung und Verwaltung | 169 | ||
| 2.2.1. „Ordoliberalismus“ und „Interventionismus“ | 169 | ||
| 2.2.2. Das „Kartellgesetz“ als sogenanntes „Grundgesetz sozialer Marktwirtschaft“ – Zurückführung der Wettbewerbsgesetzgebung auf Mißbrauchstatbestände nach dem Vorbild der Kartell-Verordnung vom 2.11.23 (Ausgabekürzung durch Aufgabenkürzung) | 170 | ||
| 2.3. Globale und individuelle Maßnahmen staatlicher Verwaltung zur Förderung der Wirtschaft – Spannung zwischen volkswirtschaftlicher Gesamtleistung und den wirtschaftlichen Einzelleistungen in den Unternehmen – Rahmenbedingungen | 175 | ||
| 2.3.1. Globale Maßnahmen | 176 | ||
| 2.3.1.1. Die Konjunktur und deren Steuerung – Umstrukturierung und Anpassung | 176 | ||
| 2.3.1.2. Das Verhältnis des Staates zu den Unternehmen im Rahmen der globalen Maßnahmen staatlicher Verwaltung – Einbeziehung gesamtwirtschaftlicher Maßnahmen in die Unternehmensstrategie – Freiwillige Kooperation von Staat und Unternehmerschaft | 178 | ||
| 2.3.2. Individuelle Maßnahmen – Notwendige Kooperation von Staat und Unternehmerschaft | 178 | ||
| D. Das Vierte (internationale) durch den Staat vermittelte Bezugssystem des Unternehmens zu anderen Staaten und deren Wirtschaft | 180 | ||
| I. Der Staat als Gestalter des außenwirtschaftlichen Geschehens in den Unternehmen | 180 | ||
| 1. Die Bestimmung der Recheneinheit – Währung, Parität und Wechselkurs | 180 | ||
| 1.1. Wesensmerkmale der Währung von Staaten mit natürlicher Wirtschaftsordnung | 181 | ||
| 1.1.1. Konvertibilitet und Multilateralität | 182 | ||
| 1.1.2. Flexibilität der Wechselkurse | 182 | ||
| 1.2. Internationalisierung der nationalen Währungen durch die Sonderziehungsrechte (SZR) und deren geldwertstabilisierende Verwendung im internationalen Geschäftsverkehr | 188 | ||
| 1.3. Mangelnde Eignung der Rechnungseinheit des Europäischen Währungssystems (ECU) für die Stabilisierung des Geldwerts | 192 | ||
| 1.4. Die „Bekämpfung der Inflation“ | 194 | ||
| 1.4.1. Feststellungen und Meinungen des Sachverständigenrats | 194 | ||
| 1.4.2. Das Operieren mit der Geldmeßwertdifferenz | 196 | ||
| 2. Der Außenwirtschaftsverkehr | 200 | ||
| 2.1. Beschränkungen nach Maßgabe des Außenwirtschaftsgesetzes vom 29. April 1961 | 201 | ||
| 2.2. Beschränkungen durch die Zugehörigkeit der Bundesrepublik Deutschland zur Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft | 201 | ||
| II. Der Staat als Förderer des außenwirtschaftlichen Geschehens in den Unternehmen | 202 | ||
| 1. Beziehungen zu Staaten mit natürlicher Wirtschaftsordnung | 202 | ||
| 2. Beziehungen zu Staaten mit Zwangsverwaltungswirtschaft | 203 | ||
| 3. Beziehungen zu Staaten der Dritten Welt (Entwicklungshilfe) – Weltwirtschaftsordnung | 203 | ||
| Dritter Teil: Der Kapitalismus als praktizierte Lehre vom Kapital in einer natürlichen Wirtschaftsordnung | 205 | ||
| Literaturverzeichnis | 215 | ||
| Namenregister | 219 | ||
| Sachregister | 221 |
