Herausforderungen der Wirtschaftspolitik
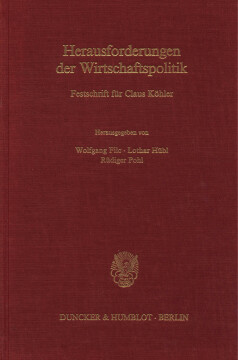
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Herausforderungen der Wirtschaftspolitik
Festschrift zum 60. Geburtstag von Claus Köhler
Editors: Filc, Wolfgang | Hübl, Lothar | Pohl, Rüdiger
(1988)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Inhalt | 5 | ||
| Karl Otto Pöhl: Vorwort des Präsidenten der Deutschen Bundesbank | 9 | ||
| I. Finanzwirtschaft und monetäre Steuerung | 13 | ||
| Karl-Heinz Berger: Zur Kooperation von Banken und Versicherungen | 15 | ||
| A. Grundlegung | 15 | ||
| B. Strategische Gesichtspunkte | 19 | ||
| I. Sortimentsplanung | 19 | ||
| II. Vertriebsorganisation | 20 | ||
| III. Kooperationstypen | 22 | ||
| C. Offene Fragen | 24 | ||
| Sonning Bredemeier: Bankbetriebliche Risiken – Evaluierung und Steuerung | 27 | ||
| I. Risiken des gewerblichen Kreditgeschäfts | 28 | ||
| II. Länderrisiko | 31 | ||
| III. Zinsänderungsrisiko | 33 | ||
| IV. Währungsrisiko | 36 | ||
| V. Finanzinnovationen | 38 | ||
| VI. Gesamtrisikoposition | 40 | ||
| Friedrich Geigant/Armin Rohde: Multifunktionalität und Stabilität im Geld- und Kreditwesen | 43 | ||
| A. Geldversorgung | 43 | ||
| I. Bankguthaben | 43 | ||
| II. Mischgeldsystem | 43 | ||
| III. Liquiditätsprobleme | 45 | ||
| 1. Ad-hoc-Aktionen des „lender of last resort“ | 46 | ||
| 2. Interbankbeziehungen | 46 | ||
| 3. Liquiditätsreserven | 47 | ||
| IV. Einzel- und gesamtwirtschaftliche Sicht | 47 | ||
| B. Intermediation | 48 | ||
| I. Brückenfunktion | 48 | ||
| II. Multifunktionalität | 48 | ||
| III. Bankbilanzstrukturen in der Bundesrepublik Deutschland | 50 | ||
| IV. Wachstumsdynamik in den Banksegmenten | 52 | ||
| C. Stabilitätsaspekte | 54 | ||
| I. Variabilität und Funktionalität | 54 | ||
| II. Störungsintensität der bilanzwirksamen Bankgeschäfte | 56 | ||
| III. Der Störfall als gesamtwirtschaftliches Syndrom | 57 | ||
| H.-J. Jarchow/H. Möller/H. Bernhöft: Eine empirische Geldangebots/Geldnachfrage-Analyse für die Bundesrepublik Deutschland vor und nach 1973 | 59 | ||
| A. Einführung | 59 | ||
| B. Ein Geldangebots/Geldnachfrage-Modell ohne Wechselkurseinflüsse | 60 | ||
| I. Schätzgleichungen und Schätzergebnisse | 60 | ||
| II. Weitere Überlegungen zum Geldangebot | 67 | ||
| C. Ein Geldangebots/Geldnachfrage-Modell mit Wechselkurseinflüssen | 70 | ||
| I. Hypothesen zum Wechselkurseinfluß | 70 | ||
| II. Schätzgleichungen | 73 | ||
| III. Schätzergebnisse | 75 | ||
| D. Abschließende Bemerkungen | 78 | ||
| Anhang: Zum verwendeten Datenmaterial | 79 | ||
| Hans-Jürgen Krupp: Ist das Wachstum des Produktionspotentials ein geeignetes Kriterium für die Geldpolitik? | 81 | ||
| A. Ist eine Orientierung der Geldpolitik an der Potentialentwicklung wachstumsgerecht? | 81 | ||
| B. Kommt es auf das tatsächliche oder das mögliche Potential an? | 83 | ||
| C. Welche Produktionsfaktoren sind bei der Potentialbestimmung zu berücksichtigen? | 86 | ||
| D. Die Berücksichtigung des Strukturwandels bei der Potentialmessung | 89 | ||
| E. Wie sicher ist eine Orientierung der Geldpolitik an der Potentialentwicklung? | 92 | ||
| Literatur | 94 | ||
| Alois Oberhauser: Änderungen in der Einkommensverteilung und Zinsbildung. Eine notwendige Ergänzung der Zinstheorie | 97 | ||
| A. Empirische Tatbestände | 98 | ||
| B. Widersprüche zwischen der herrschenden Zinstheorie und der Realität | 99 | ||
| C. Zinsunabhängige Anpassungsvorgänge | 101 | ||
| D. Das Zusammenwirken der drei Mechanismen | 106 | ||
| E. Zusammenfassende Thesen | 110 | ||
| Rüdiger Pohl: Zum Informationsbedarf geldpolitischer Strategien | 113 | ||
| A. Unsicherheit und Risiken in der Geldpolitik | 113 | ||
| B. Informationsbedarf einer strikten Geldmengenverstetigung | 117 | ||
| C. Angemessenheit des Potentialpfades | 118 | ||
| D. Soziale Kosten der Geldpolitik | 122 | ||
| E. Unsicherheit im Geldangebotsprozeß | 124 | ||
| F. Geldpolitische Konsequenzen | 125 | ||
| Literatur | 127 | ||
| II. Geld- und Kreditpolitik in der Bundesrepublik Deutschland | 129 | ||
| Leonhard Gleske: Die Geldmarktpolitik der Bundesbank Erfahrungen und Probleme | 131 | ||
| Dieter Hiss/Wolfgang Schröder: Geldmengenpolitik der Deutschen Bundesbank: Probleme der Steuerung und Interpretation | 147 | ||
| A. Einführung und Zusammenfassung | 147 | ||
| B. Die Geldmengenpolitik im wirtschaftspolitischen Gesamtrahmen | 148 | ||
| C. Das Zusammenspiel der Geldpolitik mit den Akteuren des Wirtschaftsprozesses | 150 | ||
| D. Schwankungen der Präferenzen für D-Mark | 153 | ||
| E. Internationale Einflüsse auf die Geldmengensteuerung in einer Phase der D-Mark-Aufwertung | 156 | ||
| F. Die Doppelrolle der Terms of Trade | 162 | ||
| G. Liquiditätsfallen-Syndrom | 164 | ||
| H. Ein geldpolitisches Dilemma | 165 | ||
| I. Schlußfolgerungen | 167 | ||
| Karl-Heinz Ketterer/Rainer Vollmer: Wie würden sich Zielvorgaben für das nominale Sozialprodukt auf den Konjunkturzyklus auswirken? Einige Ergebnisse empirischer Untersuchungen für die Bundesrepublik Deutschland | 169 | ||
| I. Ausgangstatbestände | 169 | ||
| II. Zur Theorie der nominalen BSP-Regel | 171 | ||
| III. Schätzung dynamischer Beziehungen zwischen Preisen und Output in der Bundesrepublik | 173 | ||
| IV. Die Politik-Regel und die Preis-Output-Reaktionen: Ergebnisse einiger Simulationen | 176 | ||
| V. Schlußbemerkungen | 182 | ||
| Anhang | 182 | ||
| Literaturverzeichnis | 183 | ||
| Norbert Kloten: Die Steuerung des Geldmarktes als Reflex monetärer Konzeptionen | 185 | ||
| I. | 185 | ||
| II. | 187 | ||
| III. | 191 | ||
| IV. | 195 | ||
| Helmut Schlesinger: Kontinuität in den Zielen, Wandel in den Methoden | 197 | ||
| A. Währungssicherung als primäres Ziel der Bundesbankpolitik | 197 | ||
| B. Das Geldmengenziel als Zwischenziel | 200 | ||
| C. Zielsetzungen und ihre Realisierung | 203 | ||
| D. Die Steuerung der Geldmenge über den Geldmarkt | 206 | ||
| E. Fazit | 209 | ||
| III. Internationale Einbindungder Wirtschaftspolitik | 211 | ||
| Wolfgang Filc: Kooperation als Voraussetzung zur Stabilisierung des internationalen Währungssystems | 213 | ||
| A. Das Auseinanderfallen der Weltwirtschaft in der Zwischenkriegszeit | 213 | ||
| B. Reaktion und Kooperation der Wirtschaftspolitik bei Interdependenz | 214 | ||
| I. Interdependenzen | 214 | ||
| II. Realisierung wirtschaftspolitischer Ziele bei Auslandseinflüssen | 215 | ||
| III. Internationales Politikgleichgewicht bei reaktivem Verhalten | 216 | ||
| IV. Internationales Politikgleichgewicht bei Kooperation | 219 | ||
| V. Konsequenzen für die wirtschaftspolitische Kooperation zwischen den großen Industrieländern | 221 | ||
| C. Kooperation als Voraussetzung zur Stabilisierung des internationalen Währungssystems | 224 | ||
| I. Der Wechselkurs als Ziel der Wirtschaftspolitik | 224 | ||
| II. Ursachen von Wechselkursänderungen | 225 | ||
| III. Ansatzpunkte zur Stabilisierung der Wechselkurse | 229 | ||
| D. Ausblick | 230 | ||
| Karl Häuser: Keynes und die Schuldenkrise | 233 | ||
| A. Vorbemerkungen | 233 | ||
| B. Keynes‘ Erfahrungen und Befassungen mit internationaler Verschuldung | 234 | ||
| I. Biographisches und Bibliographisches | 234 | ||
| II. Das Reparationsproblem und Versailles | 236 | ||
| III. Das Spektrum weiterer Schuldenprobleme | 238 | ||
| C. Paradigmatische Analyse und Prognose eines Schuldenproblems: Deutschlands Reparationsschulden | 240 | ||
| Heiko Körner: Interne Ursachen der Verschuldungsproblematik. Interessen, Strukturdefizite und Politikversagen in Entwicklungsländern | 247 | ||
| A. | 247 | ||
| B. | 251 | ||
| C. | 255 | ||
| Wilhelm Nölling: Europawährung 2000? Stand und Aussichten einer europäischen Währungsintegration | 261 | ||
| A. Monetäre Zusammenarbeit in Europa | 261 | ||
| I. Werner-Plan und EWS | 261 | ||
| II. Der Faktor „Zeitbedarf“ | 263 | ||
| III. Wandel des Umfeldes bis zum Jahr 2000 | 264 | ||
| B. Wechselkursstabilität und Konvergenz im EWS | 264 | ||
| C. Beseitigung von Unvollkommenheiten der Anfangsphase | 266 | ||
| I. Liberalisierung des Kapitalverkehrs | 267 | ||
| II. Vollmitgliedschaft Großbritanniens | 269 | ||
| D. Grundsatzfragen zur Währungsunion | 270 | ||
| I. Vorteile eines engeren Währungszusammenschlusses | 271 | ||
| II. Voraussetzungen für eine Währungsunion | 272 | ||
| 1. Die Bedeutung von Erfahrungsgewinnen für das weitere Vorgehen | 273 | ||
| 2. Nichthomogenität als „Sprengsatz“? | 274 | ||
| III. Zur Auswahl der integrationspolitischen Optionen | 275 | ||
| E. Konkrete Arbeit am unvollendeten Objekt | 279 | ||
| I. Forcierung der privaten und offiziellen ECU-Verwendung | 279 | ||
| II. Ausweitung der Kredit- und Beistandsfazilitäten | 283 | ||
| III. Intramarginale Interventionen | 284 | ||
| IV. Koordinierung von Zinssatzänderungen und Formulierung gemeinschaftlicher Geldmengenziele | 286 | ||
| V. Technisch bessere Handhabung von Wechselkurs-Anpassungen | 288 | ||
| VI. Gemeinsame Währungspolitik nach außen | 288 | ||
| VII. Verbesserung der Zusammenarbeit auf dem Wege institutioneller Weiterungen und Kompetenzzuweisungen | 290 | ||
| F. Aussichten | 292 | ||
| Reinhard Pohl: Staatsdefizite und Zahlungsbilanz | 277 | ||
| I. | 297 | ||
| II. | 302 | ||
| Erste These: Das Staatsdefizit ist die Ursache des Leistungsbilanzdefizits im Lande A. | 303 | ||
| Zweite These: Der Saldo im Staatshaushalt ist die Folge eines gleichgerichteten Saldos in der Leistungsbilanz des Landes B. | 303 | ||
| Dritte These: Investitionen und Finanzierungsdefizite der Unternehmen sind die Ursache eines Leistungsbilanzdefizits des Landes B. | 304 | ||
| Vierte These: Das Finanzierungsdefizit der Unternehmen ist die Folge eines Leistungsbilanzdefizits | 306 | ||
| III. | 306 | ||
| Fünfte These: Das Finanzierungsdefizit des Staates bewirkt über eine Erhöhung der Zinsen, des Außenwertes der eigenen Währung, des Kapitalimportes ein Leistungsbilanzdefizit | 306 | ||
| Sechste These: Eine z. B. steuerpolitisch bedingte Verbesserung des Investitionsklimas führt zu Kapitalimporten, zu einer Zunahme des Außenwertes der eigenen Währung und zu Leistungsbilanzdefiziten | 307 | ||
| IV. | 308 | ||
| Literatur | 311 | ||
| IV. Wirtschaftspolitische Konzeptionen und Koordinierungaufgaben | 313 | ||
| Werner Ehrlicher: Wandlungen in den Konzepten der Geld-, Finanz- und Lohnpolitik 1948–1986 | 315 | ||
| A. Einführung | 315 | ||
| B. Die Periode anhaltend hohen Wirtschaftswachstums (1948–1967) | 317 | ||
| I. Die Wirtschaftsentwicklung | 317 | ||
| II. Antizyklische Geldpolitik | 318 | ||
| III. Wachstumsorientierte Finanzpolitik | 320 | ||
| IV. Stabilitäts- und wachstumsadäquate Lohnpolitik | 322 | ||
| C. Vermindertes Wachstum bei zunehmender Inflation (1967–1975) | 324 | ||
| I. Die Wirtschaftsentwicklung | 324 | ||
| II. Geldpolitik bei zunehmender Inflation | 325 | ||
| III. Antizyklische Finanzpolitik | 326 | ||
| IV. Harter Verteilungskampf | 328 | ||
| D. Konsolidierung bei niedrigem Wachstum (1976–1986) | 330 | ||
| I. Die Wirtschaftsentwicklung | 330 | ||
| II. Geldpolitik mit Geldmengenziel | 330 | ||
| III. Längerfristig orientierte Finanzpolitik | 332 | ||
| IV. Beschäftigungsorientierte Lohnpolitik | 333 | ||
| E. Zusammenfassung | 335 | ||
| Werner Glastetter: Mehr Wachstum für mehr Beschäftigung Zur Begründung und Relativierung einer gängigen These | 337 | ||
| A. Die Ausgangssituation | 337 | ||
| B. Steigende Wachstums- und Beschäftigungsdefizite | 338 | ||
| C. Problematischer Vorrang für Preisstabilität | 341 | ||
| D. Überforderte lohnpolitische Alleinverantwortung | 342 | ||
| E. Hemmnisse für mehr Wachstum und Beschäftigung | 346 | ||
| F. Anhaltende Stetigkeit des realen Wachstumspfades | 350 | ||
| G. Hohes Gewicht der Produktivitätsschere | 352 | ||
| H. Fazit: Policy-mix und Konsens | 354 | ||
| Lothar Hübl: Anmerkungen zur großräumigen wirtschaftlichen Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland – Konsequenzen für die Wirtschaftspolitik | 357 | ||
| A. Regionale Abgrenzung | 358 | ||
| B. Kennzeichnung der Entwicklung | 358 | ||
| C. Ursachenanalyse | 364 | ||
| I. Strukturunterschiede | 365 | ||
| II. Wettbewerbsunterschiede | 368 | ||
| D. Automatischer Gefälleabbau? | 370 | ||
| E. Wirtschaftspolitische Konsequenzen | 372 | ||
| Kurt Nemitz Stabilitätspolitik und Konsensbildung | 375 | ||
| V. Anhang | 389 | ||
| Auswahl aus den Veröffentlichungen von Claus Köhler 1949–1986 | 391 | ||
| A. Bücher | 391 | ||
| B. Beteiligung an Gutachten des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung | 392 | ||
| C. Artikel in wissenschaftlichen Zeitschriften | 393 | ||
| I. Periodische Analysen der konjunkturellen und monetären Entwicklung | 393 | ||
| II. Andere Artikel in wissenschaftlichen Zeitschriften | 393 | ||
| D. Beiträge in Sammelwerken | 395 | ||
| E. Beiträge in allgemeinen Zeitschriften und in Berichten von Kreditinstituten | 396 | ||
| F. Buchbesprechungen | 396 | ||
| G. Artikel in überregionalen Tageszeitungen | 397 | ||
| H. Veröffentlichte Vorträge | 398 | ||
| I. Herausgebertätigkeit | 398 | ||
| Verzeichnis der Autoren | 399 |
