Geld und Unterbeschäftigung
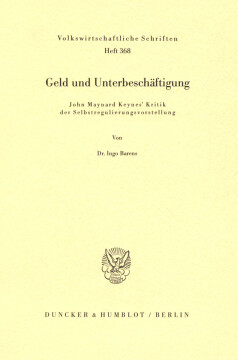
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Geld und Unterbeschäftigung
John Maynard Keynes' Kritik der Selbstregulierungsvorstellung
Volkswirtschaftliche Schriften, Vol. 368
(1987)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorbemerkung | 1 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 5 | ||
| 1. Einleitung | 11 | ||
| 1.1 Problemstellung | 11 | ||
| 1.2 Vorgehensweise und Aufbau der Studie | 17 | ||
| 2. Instabilität, Unterbeschäftigung und Selbstregulierung | 20 | ||
| 2.1 Grundzüge der gegenwärtigen Diskussion um Keynes: Selbstregulierung und Instabilität | 20 | ||
| 2.1.1 Aspekte der Selbstregulierungsproblematik in der gegenwärtigen Diskussion: ein Überblick | 20 | ||
| 2.1.2 Das Gemeinsame in der Vielfalt: Instabilität als Selbstregulierungsproblem | 23 | ||
| 2.1.3 Selbstregulierung und Instabilität: unfreiwillige Arbeitslosigkeit als Phänomen von Ungleichgewichtsprozessen | 25 | ||
| 2.2 Die marginalistische Selbstregulierungsvorstellung: Selbstregulierung und Vollbeschäftigung | 27 | ||
| 2.3 Gleichgewicht als Gravitationszentrum | 31 | ||
| 2.3.1 Methodische und theoretische Aspekte der Gleichgewichtsvorstellung | 31 | ||
| 2.3.2 Bestimmung und Verwirklichung eines Gravitationszentrums | 33 | ||
| 2.3.3 Gleichgewicht als Gravitationszentrum und Selbstregulierung | 36 | ||
| 2.4 Keynes’ Kritik der Selbstregulierung: Gravitationszentrum bei Unterbeschäftigung | 39 | ||
| 2.4.1 „Das ökonomische System ist nicht selbstregulierend!“ | 39 | ||
| 2.4.2 Das Problem der Selbstregulierung in den Vorarbeiten zur „Allgemeinen Theorie ...“ | 41 | ||
| 2.4.3 Das Konzept eines Gravitationszentrums in der „Allgemeinen Theorie ...“ | 44 | ||
| 2.4.4 Selbstregulierung und Gravitationszentrum bei Unterbeschäftigung | 50 | ||
| 2.5 Zusammenfassung der Ergebnisse | 55 | ||
| 3. Die monetäre Gesamtnachfrage als „Barriere“: „Monetäre Theorie der Produktion“ – Keynes’ erstes Konzept einer Geldwirtschaft | 57 | ||
| 3.1 Die Abhandlung „Vom Gelde“ als Ausgangspunkt | 57 | ||
| 3.2 Die „Bananen-Parabel“ oder das Problem labiler Gleichgewichtslagen in der Abhandlung „Vom Gelde“ | 62 | ||
| 3.3 Abflüsse aus dem Einkommenskreislauf und die Stabilität der Gleichgewichtslage – Keynes’ erste und entscheidende Erkenntnis | 66 | ||
| 3.3.1 Die Lösung der „Bananen-Parabel“: Keynes’ Entdeckung der Stabilitätsbedingung | 67 | ||
| 3.3.2 Von der Stabilitätsbedingung zur Konsumneigung | 72 | ||
| 3.3.3 Einkommensveränderungen als Anpassungsmechanismus und die Möglichkeit einer Gleichgewichtslage bei Unterbeschäftigung | 76 | ||
| 3.3.4 Induzierte Abflüsse, autonome Zuflüsse und die Stabilität der Gleichgewichtslage: einige Bemerkungen zu Keynes’ Vorgehen und Lösung | 78 | ||
| 3.3.5 Ausblick auf die weiterführenden Fragen | 83 | ||
| 3.4 Effektive Nachfrage als „Barriere“: Keynes’ Verständnis und Kritik des Sayschen Gesetzes | 83 | ||
| 3.4.1 Das Saysche Gesetz: ein dogmenhistorischer Überblick | 84 | ||
| 3.4.2 Keynes’ Verständnis des Sayschen Gesetzes | 91 | ||
| 3.4.3 Keynes’ Kritik des Sayschen Gesetzes und ihre Konsequenz | 98 | ||
| 3.4.4 Effektive Nachfrage und die Möglichkeit einer „Barriere“: Keynes’ grundlegende „Vision“ | 101 | ||
| 3.5 Die Möglichkeit von Abflüssen aus dem Einkommenskreislauf: die „wesentlichen Eigenschaften“ des Geldes | 103 | ||
| 3.5.1 Einleitende Bemerkungen | 103 | ||
| 3.5.2 Geld und die für Abflüsse notwendigen Bedingungen | 104 | ||
| 3.5.3 Die für Abflüsse notwendigen Bedingungen als „wesentliche Eigenschaften“ des Geldes | 106 | ||
| 3.5.4 Lagerfähigkeit als „wesentliche Eigenschaft“ des Geldes | 107 | ||
| 3.5.5 Nichtproduzierbarkeit als „wesentliche Eigenschaft“ des Geldes | 107 | ||
| 3.5.6 Geld und nicht-kompensierte Abflüsse | 110 | ||
| 3.6 Geldprofite und Unternehmermotivation | 111 | ||
| 3.6.1 Geldorientierte versus produktorientierte Unternehmermotivation | 112 | ||
| 3.6.2 Produktorientierte Unternehmermotivation in der „Klassischen Theorie“ | 114 | ||
| 3.6.3 Die Nichtäquivalenz von Geld- und Produktorientierung | 116 | ||
| 3.7 Das Konzept einer Geldwirtschaft (I): die „Unternehmerwirtschaft“ | 117 | ||
| 3.7.1 Die Grundzüge einer „Unternehmerwirtschaft“ | 118 | ||
| 3.7.2 Die Unternehmerwirtschaft als Entgegnung auf J. St. Mill | 121 | ||
| 3.8 Ein Spektrum von Modellökonomien: die „stillschweigenden Annahmen“ der „Klassischen Theorie“ (I) | 123 | ||
| 3.8.1 Abflüsse und Modellökonomien | 124 | ||
| 3.8.2 Die „Transformationsbedingungen“ | 128 | ||
| 3.8.3 Die „stillschweigenden Annahmen“ der „Klassischen Theorie“ (I) | 130 | ||
| 3.9 Ersparnisse, Investitionen und der Multiplikator: der Wandel in der Fragestellung | 131 | ||
| 3.9.1 Der Weg zum Multiplikatorkonzept | 132 | ||
| 3.9.2 Der Wandel in der Fragestellung | 137 | ||
| 4. Der Geldzinssatz als „Barriere“: „Monetäre Theorie des Zinses“ – Keynes’ zweites Konzept einer Geldwirtschaft | 139 | ||
| 4.1 Rückblick auf die bisherigen Ergebnisse | 139 | ||
| 4.2 Die Theorie der Investition: Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals | 140 | ||
| 4.2.1 Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals und Marginalistische Theorie | 141 | ||
| 4.2.2 Ungewißheit, Erwartungen und die Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals | 145 | ||
| 4.3 Die Theorie des Zinssatzes: Liquiditätspräferenz | 150 | ||
| 4.3.1 Grundzüge der „Klassischen Theorie des Zinssatzes“ | 151 | ||
| 4.3.2 Die „Monetäre Theorie des Zinssatzes“ als zinstheoretische Konsequenz der kreislauftheoretischen Analyse | 154 | ||
| 4.3.3 Keynes’ Begründungen der Liquiditätspräferenz | 158 | ||
| 4.3.4 Ungewißheit und die „Monetäre Theorie des Zinssatzes“ | 161 | ||
| 4.4 Die Struktur der „Allgemeinen Theorie ...“ | 162 | ||
| 4.5 Die „wesentlichen Eigenschaften“ des Geldes und des Geldzinses | 166 | ||
| 4.5.1 Das Konzept des Eigenzinssatzes | 168 | ||
| 4.5.2 Die Konstanz als „wesentliche Eigenschaft“ des Geldzinssatzes | 172 | ||
| 4.5.3 Die für die Konstanz des Geldzinssatzes notwendigen Bedingungen | 174 | ||
| 4.5.4 Die für die Konstanz des Geldzinssatzes notwendigen Bedingungen als „wesentliche Eigenschaften“ des Geldes | 177 | ||
| 4.5.5 Geld, Geldzinssatz und Unterbeschäftigung | 180 | ||
| 4.6 Das Konzept einer Geldwirtschaft (II) | 182 | ||
| 4.7 Die „stillschweigenden Annahmen“ der „Klassischen Theorie“ (II) | 185 | ||
| 4.8 Nicht-Neutralität des Geldes und Selbstregulierung: Geldzinssatz und Gravitationszentrum bei Unterbeschäftigung | 189 | ||
| 4.8.1 Inhalt und Begründung der Selbstregulierungskritik von Keynes | 189 | ||
| 4.8.2 Nicht-Neutralität des Geldes und die Trennung von Wert- und Geldtheorie | 192 | ||
| 4.8.3 Gravitationszentrum und die Ungewißheit kurz- und langfristiger Erwartungen | 193 | ||
| 4.8.4 Wirtschaftspolitische Implikationen eines Gravitationszentrums bei Unterbeschäftigung | 196 | ||
| 4.8.5 Bedeutung der Nicht-Neutralität des Geldes bei Keynes | 201 | ||
| 4.8.6 Gravitationszentrum bei Unterbeschäftigung, Leben im Übergang und langfristige Lebenserwartungen | 202 | ||
| 5. „Barrieren“ und Unterbeschäftigung: die logische Struktur von Keynes’ Kritik der Selbstregulierung und der Wandel in der Bedeutung des Geldes | 205 | ||
| 5.1 Die bisherigen Ergebnisse | 205 | ||
| 5.1.1 Kreislaufanalytische und zinsanalytische Ebenen in Keynes’ Theorie der Beschäftigung und Kritik der Selbstregulierung | 205 | ||
| 5.1.2 Die beiden Konzepte einer „Geldwirtschaft“ | 207 | ||
| 5.1.3 Das „Verschwinden“ des ersten Konzepts einer „Geldwirtschaft“ | 208 | ||
| 5.2 Die beiden Konzepte einer „Geldwirtschaft“ und die Kritik der Selbstregulierung | 209 | ||
| 5.2.1 Der Wandel in der selbstregulierungskritischen Bedeutung des Geldes | 210 | ||
| 5.2.2 Die Gründe für das „Verschwinden“ des ersten Konzepts einer „Geldwirtschaft“ | 212 | ||
| 5.3 Die Konsequenzen | 218 | ||
| 5.3.1 „Monetäre Theorie der Produktion“, Nicht-Neutralität des Geldes und die Theorie der Effektiven Nachfrage | 219 | ||
| 5.3.2 Der Stellenwert der Ungewißheit in Keynes’ Kritik der Selbstregulierung | 221 | ||
| 6. Die „Liquiditätsfalle“ als letzte „Barriere“: Geldlöhne, Geldzinssatz und Selbstregulierung | 225 | ||
| 6.1 Flexible Geldlöhne und Geldzinssatz: die Problemstellung | 225 | ||
| 6.2 Flexible Geldlöhne und Geldzinssatz in den Vorarbeiten zur „Allgemeinen Theorie ...“ | 226 | ||
| 6.3 Flexible Geldlöhne und Geldzinssatz in der „Allgemeinen Theorie ...“ | 228 | ||
| 6.4 Die „Liquiditätsfalle“ als letzte „Barriere“ | 231 | ||
| 6.5 Die Bedeutung der „Liquiditätsfalle“ in der gegenwärtigen Diskussion | 234 | ||
| 6.6 Die Konsequenzen des Scheiterns von Keynes’ Kritik der Selbstregulierung | 238 | ||
| 6.7 Zusammenfassung der Ergebnisse | 240 | ||
| 7. Die Relevanz von „Barrieren“: Schlußfolgerung und Ausblick | 242 | ||
| 7.1 Geld und Unterbeschäftigung bei Keynes: die selbstregulierungskritische Relevanz von „Barrieren“ | 242 | ||
| 7.2 Zur Irrelevanz von „Barrieren“: Geld und Unterbeschäftigung erneut betrachtet | 249 | ||
| Anhang I: „Monetary Theory of Production“: Erläuterungen zu Keynes’ Beitrag zur Festschrift für Spiethoff | 254 | ||
| Anhang II: Von der „Monetären Theorie der Produktion“ zur „Allgemeinen Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes“: das Schicksal eines Begriffs | 264 | ||
| Anhang III: Die letzten Spuren der Vorarbeiten in der „Allgemeinen Theorie...“ | 268 | ||
| Abkürzungsverzeichnis | 272 | ||
| Literaturverzeichnis | 273 |
