Verhaltensforschung und Recht
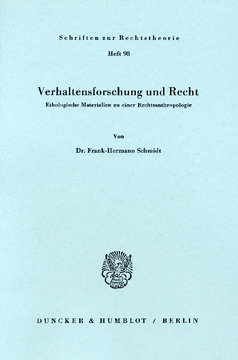
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Verhaltensforschung und Recht
Ethologische Materialien zu einer Rechtsanthropologie
Schriften zur Rechtstheorie, Vol. 98
(1982)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 5 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 7 | ||
| I. Verhaltensforschung und Rechtsanthropologie | 13 | ||
| 1. Natur und Recht aus der Sicht von Verhaltensforschern | 13 | ||
| a) Thesen zu den biologischen Grundlagen rechtlichen Verhaltens | 13 | ||
| b) Argumente für eine biologische Fundierung rechtlichen Verhaltens | 16 | ||
| (1) „Moral-analoges" Verhalten bei Tieren | 16 | ||
| (2) Verhaltensprogrammierungen beim Menschen | 17 | ||
| (3) Biologische Wertprogrammierungen als Grundlage kultureller Wertsetzungen | 19 | ||
| c) Zum Verhältnis biologischer und kultureller „Normierung" | 20 | ||
| 2. Probleme der Übernahme humanethologischer Forschungsergebnisse | 22 | ||
| 3. Die Konzeption der Darstellung | 23 | ||
| II. Grundlagen der Verhaltensforschung | 26 | ||
| 1. Die Grundlagen | 26 | ||
| a) Die Fragestellung | 26 | ||
| b) Evolutionstheorie | 27 | ||
| c) Evolutionstheorie und Verhalten | 28 | ||
| 2. Fragestellungen und Methoden | 30 | ||
| a) Das Ethogramm | 30 | ||
| b) Ursachen, Zwecke und Entwicklung von Verhaltensweisen | 31 | ||
| c) Homologieforschung | 32 | ||
| d) Die Bedeutung der Umwelt | 35 | ||
| e) Analogieforschung | 35 | ||
| 3. Grundlegende Ergebnisse | 36 | ||
| a) Instinktverhalten | 36 | ||
| b) Angeborenes und erlerntes Verhalten | 39 | ||
| (1) Der Begriff des „Angeborenen" | 39 | ||
| (2) Lernen | 40 | ||
| (3) Die angeborenen Grundlagen des Lernens | 41 | ||
| IIΙ. Humanethologie | 43 | ||
| 1. Der Mensch als Gegenstand der Verhaltensforschung | 43 | ||
| a) Evolutionstheorie und menschliches Verhalten | 43 | ||
| b) Fragestellungen | 44 | ||
| 2. Methoden | 45 | ||
| a) Beobachtungen am Menschen | 45 | ||
| (1) Beobachtungen an Säuglingen und Kleinkindern | 45 | ||
| (2) Kulturenvergleich | 46 | ||
| (3) Beobachtungen an Geisteskranken | 47 | ||
| b) Tier-Mensch-Vergleich | 48 | ||
| (1) Die Suche nach Arbeitshypothesen und Lösungshinweisen | 49 | ||
| (2) Analogieforschung | 51 | ||
| (3) Homologieforschung | 52 | ||
| 3. Methodenprobleme | 54 | ||
| a) Intelligenzentwicklung und Instinktreduktion | 55 | ||
| b) Lernen | 56 | ||
| c) Kultur | 58 | ||
| d) Sprache, Ich-Bewußtsein, Werkzeugbenutzung | 59 | ||
| e) Die „moralische" Kritik der Verhaltensforschung | 62 | ||
| f) Die Kritik mangelnder wissenschaftlicher Genauigkeit | 64 | ||
| g) Die Unvollständigkeit der bisherigen Forschungen | 65 | ||
| 4. Folgerungen | 67 | ||
| IV. Familienbildung | 69 | ||
| 1. Erscheinungsformen | 70 | ||
| a) Allgemeine Züge | 70 | ||
| b) Primaten | 71 | ||
| 2. Mechanismen der Familienbindung | 74 | ||
| a) Sexualverhalten | 75 | ||
| b) Die Bindungsmechanismen der Mantelpaviane | 76 | ||
| c) Verwandtschaftsbeziehungen | 78 | ||
| 3. Funktionen der Familienbildung | 79 | ||
| a) Allgemeines | 79 | ||
| b) Monogame Paarbeziehungen | 79 | ||
| c) Gruppenbildung | 81 | ||
| 4. Genetische Grundlagen der Familienbildung, Umwelteinflüsse und andere Einflußfaktoren | 82 | ||
| a) Genetische Determinierungen | 82 | ||
| b) Umwelteinflüsse | 82 | ||
| c) Zum Zusammenwirken von Veranlagung und Umwelteinflüssen | 84 | ||
| d) Weitere Einflußfaktoren | 85 | ||
| 5. Folgerungen für die Grundlagen menschlicher Familienorganisation | 86 | ||
| a) Keine homologe Familienstruktur der Primaten | 86 | ||
| b) Selektion auf monogame Partnerbeziehungen? | 88 | ||
| c) Gen-Selektions-Theorie und Familienorganisation | 89 | ||
| d) Die Rolle der Sexualität | 89 | ||
| e) Inzesthemmungen | 90 | ||
| V. Brutpflege | 94 | ||
| 1. Erscheinungsformen | 94 | ||
| a) Allgemeines | 94 | ||
| b) Primaten | 94 | ||
| 2. Funktionen | 96 | ||
| a) Primäre Funktionen | 96 | ||
| b) Abgeleitete Funktionen | 96 | ||
| 3. Mechanismen | 98 | ||
| a) Angeborene Grundlagen | 98 | ||
| b) Die Rolle des Lernens | 98 | ||
| c) Die Bedeutung der Gruppe | 98 | ||
| 4. Angeborene Verhaltensdispositionen des Menschen im Bereich der Brutpflege | 99 | ||
| a) Das Mutter-Kind-Band | 99 | ||
| b) Betreuungsverhalten gegenüber Kleinkindern | 100 | ||
| c) Die Bedeutung des sozialen Umfeldes | 101 | ||
| d) Zur rechtspolitischen Berücksichtigung des Mutter-Kind-Bandes | 101 | ||
| VI. Altruismus | 103 | ||
| 1. Erscheinungsformen | 103 | ||
| a) Allgemeines | 103 | ||
| b) Altruismus bei Primaten | 104 | ||
| 2. Funktionen altruistischen Verhaltens | 106 | ||
| a) Brutpflege | 107 | ||
| b) Verwandtenhilfe | 107 | ||
| c) Herden- und Schwarmverhalten | 109 | ||
| 3. Menschlicher Altruismus | 111 | ||
| a) Genetische Grundlagen | 111 | ||
| b) Kulturelle Erweiterung | 112 | ||
| c) Das Ungenügen des Altruismus | 113 | ||
| VII. Territorialverhalten | 115 | ||
| 1. Erscheinungsformen | 116 | ||
| a) Typen von Territorien | 117 | ||
| (1) Grundformen | 117 | ||
| (2) Abwandlungen | 117 | ||
| (3) Größen | 118 | ||
| b) Territorialverhalten bei Primaten | 118 | ||
| (1) Schimpansen | 118 | ||
| (2) Andere Primaten | 119 | ||
| (3) Individualdistanzen | 121 | ||
| (4) Besitzachtung | 121 | ||
| 2. Erwerb und Sicherung von Territorien | 121 | ||
| a) Erwerb | 121 | ||
| b) Verteidigung | 122 | ||
| c) Grenzmarkierung | 123 | ||
| d) Achtung der Reviergrenzen | 124 | ||
| 3. Funktionen der Territorialität | 125 | ||
| 4. Grundlagen menschlichen Territorialverhaltens | 126 | ||
| a) Zur Territorialität heutiger Jäger-Sammler-Völker | 126 | ||
| b) Instinktbasis? | 127 | ||
| VIII. Rangordnung und Gehorsam | 129 | ||
| 1. Erscheinungsformen | 129 | ||
| a) Allgemeines | 129 | ||
| b) Die Primaten | 130 | ||
| 2. Rangerwerb | 133 | ||
| a) Körperliche Überlegenheit und Kampfbereitschaft | 134 | ||
| b) Intelligenz | 135 | ||
| c) Kooperation | 135 | ||
| d) Verpaarung, „Sexuelle Attraktivität", Führen von Jungen | 136 | ||
| e) Rangübertragung | 136 | ||
| f) Jugend, Alter | 137 | ||
| g) Zusammenfassung | 137 | ||
| 3. Stabilität von Rangordnungen | 137 | ||
| 4. Umweltfaktoren | 138 | ||
| 5. Funktionen | 139 | ||
| a) Konfliktregulierung | 139 | ||
| b) Orientierung | 140 | ||
| c) Schutz | 141 | ||
| d) Fortpflanzung | 142 | ||
| e) Regulierung der Populationsdichte | 143 | ||
| f) Mittelbarer Nutzen | 143 | ||
| 6. Genetische Grundlagen | 145 | ||
| 7. Menschliche Rangordnungen | 146 | ||
| a) Ähnlichkeiten | 146 | ||
| b) Genetische Grundlagen menschlicher Rangordnungen? | 147 | ||
| c) Rangordnungen und Recht | 150 | ||
| IX. Aggression und Aggressionshemmungen | 152 | ||
| A. Aggression | 152 | ||
| 1. Definition | 153 | ||
| 2. Erscheinungsformen | 153 | ||
| a) Allgemeines | 153 | ||
| b) Die Primaten | 154 | ||
| c) Ähnlichkeiten des menschlichen Aggressionsverhaltens | 156 | ||
| 3. Funktionen | 156 | ||
| a) Tierische Aggression | 156 | ||
| (1) „Spacing out" | 156 | ||
| (2) Anpassung | 157 | ||
| (3) Spezialisierung | 157 | ||
| (4) Genom-Erhaltung | 158 | ||
| (5) Schutz von „Investitionen" | 158 | ||
| b) Menschliche Aggression | 159 | ||
| 4. Umwelteinflüsse | 159 | ||
| 5. Mechanismen des Aggressionsverhaltens | 160 | ||
| a) Tierische Aggression | 160 | ||
| b) Menschliche Aggression | 162 | ||
| (1) Kulturübergreifende Gemeinsamkeiten | 162 | ||
| (2) Territoriale Verdrängung | 163 | ||
| (3) Lustmotivation der Aggression | 163 | ||
| (4) Zur Dysfunktionalität der Aggression | 163 | ||
| B. Aggressionshemmungen | 164 | ||
| 1. Formen | 164 | ||
| a) Allgemeines | 164 | ||
| (1) Kampfrituale | 164 | ||
| (2) Kommentkämpfe | 165 | ||
| (3) Tötungshemmungen | 165 | ||
| (4) Grenzen und Fehlen von Tötungshemmungen | 166 | ||
| b) Primaten | 167 | ||
| c) Menschliche Aggressionshemmungen | 168 | ||
| 2. Funktionen | 169 | ||
| a) Arterhaltung | 169 | ||
| b) Gruppenselektion | 170 | ||
| c) Gen-Selektion | 171 | ||
| 3. Mechanismen | 172 | ||
| a) Tierische Aggression | 172 | ||
| b) Menschliche Aggression | 172 | ||
| X. Schluß | 175 | ||
| Literaturverzeichnis | 177 |
