Rechtswandel
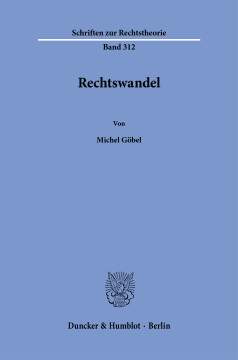
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Rechtswandel
Schriften zur Rechtstheorie, Vol. 312
(2025)
Additional Information
Book Details
About The Author
Michel Göbel studierte Rechtswissenschaft an der Goethe-Universität Frankfurt am Main mit dem Schwerpunkt Grundlagen des Rechts. Dort ist er seit 2021 an der Professur für Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie von Prof. Dr. Uwe Volkmann als Wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig. Seit Juli 2024 ist er Rechtsreferendar im Landgerichtsbezirk Frankfurt am Main. 2025 wurde er vom Fachbereich Rechtswissenschaft der Goethe-Universität mit einer rechtstheoretischen Arbeit promoviert.Abstract
Die Arbeit löst die schillernde Figur des Verfassungswandels aus ihrer verfassungsspezifischen Engführung, mit welcher sich in einer konstitutionalisierten Rechtsordnung die aufgeworfenen Probleme nicht adäquat erfassen lassen, und entwickelt vor diesem Hintergrund die übergreifende Kategorie des Rechtswandels. Das in Abgrenzung zu anderen Kategorien der informellen Rechtsentwicklung spezifische Moment des Wandels ist die sich im praktischen Ergebnis auswirkende generelle Veränderung der einer Norm zugrundeliegenden bzw. zugeschriebenen Wertung. Damit eröffnet der Rechtswandel neue Perspektiven auf grundlegende rechts- und demokratietheoretische Fragen und macht Verbindungslinien zwischen der herrschenden Rechtspraxis und unserer verrechtlichten Debattenkultur deutlich. Die Arbeit entfaltet diese Blickwinkel und Zusammenhänge, unterzieht den so beleuchteten Zustand des Rechtssystems einer Kritik und unternimmt eine Rückbindung der Abhilfevorschläge an die juristische Methodenlehre.»Legal Change«: In German constitutional law ›Verfassungswandel‹ means a change in the meaning of constitutional provisions without explicit amendments to the text of the constitution. It is to be distinguished from a mere change of interpretation in specific cases. The thesis applies this idea to any kind of law (›Rechtswandel‹). This perspective opens up new insights into fundamental questions of legal and democratic theory. Against this backdrop, the thesis criticizes the prevailing legal practice.
