Die Sachbeschädigung
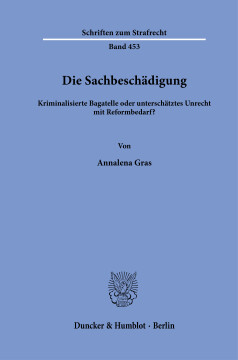
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Die Sachbeschädigung
Kriminalisierte Bagatelle oder unterschätztes Unrecht mit Reformbedarf?
Schriften zum Strafrecht, Vol. 453
(2025)
Additional Information
Book Details
Pricing
About The Author
Annalena Gras studierte zunächst Wirtschaftsrecht an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm, bevor sie das Studium der Rechtswissenschaft an der Friedrich-Alexander-Universität begann und im Termin 2022/II die Erste Juristische Staatsprüfung ablegte. Im Anschluss promovierte sie bis Ende 2024 an der Friedrich-Alexander-Universität, wo sie seit 2021 auch als Wissenschaftliche Mitarbeiterin arbeitet. Daneben war sie an der Technischen Hochschule in Nürnberg als Lehrbeauftragte für Internationales Wirtschaftsrecht und als Junior Counsel bei PUMA tätig. Seit Oktober 2023 absolviert sie ihr Referendariat am OLG Nürnberg.Abstract
Die Sachbeschädigung nach §§ 303-305a StGB wird häufig als Bagatelle eingeordnet, was durch ihre vergleichsweise geringe Strafandrohung unterstrichen wird. Dabei stellt sie nicht nur die potenziell intensivste Eigentums- bzw. Sachbeeinträchtigung dar, sondern gehört auch zu den in Deutschland am häufigsten begangenen Straftaten und führt gesamtgesellschaftlich betrachtet zu enormen Gefahren und Schäden. Die Arbeit analysiert deshalb die historische Entwicklung der Sachbeschädigung als relativ junges Strafdelikt und zeigt unter Würdigung ihrer praktischen Relevanz sowie verfassungsrechtlicher Grundsätze auf, wieso sie auch heute noch strafwürdig ist. Unter Berücksichtigung dieser Strafwürdigkeitsbewertung sowie inspiriert von Vergleichen mit der Sachbeschädigung in ausländischen Rechtsordnungen, mit zivilrechtlichen Parallelvorschriften und mit anderen Eigentumsdelikten werden sodann im Anschluss Reformmöglichkeiten diskutiert und konkrete Kodifikationsvorschläge ausgearbeitet.»Property Damage - Criminalized Triviality or Underestimated Injustice?«: Property damage according to §§ 303 ff. StGB as the potentially most intense material impairment is wrongly given a trivial image. Neither its historical development nor comparisons with other property offenses can explain where this image comes from. Therefore, this work concludes that property damage is not only justifiably punishable as is but also shows potential for reform. These various ideas for reform are first discussed and then respectively elaborated as codification proposals.
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 5 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 7 | ||
| Abkürzungsverzeichnis | 12 | ||
| Einleitung: Die Sache mit der Sachbeschädigung | 15 | ||
| 1. Teil: Hintergründe der Sachbeschädigungsstrafbarkeit | 18 | ||
| A. Historische Entwicklung der Sachbeschädigung | 18 | ||
| I. Strafgesezbuch für das Königreich Baiern | 19 | ||
| II. Strafgesetzbuch für die Preußischen Staaten | 21 | ||
| III. Strafgesetzbuch für den Norddeutschen Bund bis heute | 24 | ||
| IV. Strafgesetzbuch der Deutschen Demokratischen Republik | 29 | ||
| B. Überblick über die Sachbeschädigung | 32 | ||
| I. Sachbeschädigung, § 303 StGB | 32 | ||
| 1. Schutzgut der Sachbeschädigung | 32 | ||
| a) Frühere Diskussionen | 33 | ||
| b) Schutzgut aus heutiger Sicht | 35 | ||
| 2. Tatobjekt | 37 | ||
| a) Eigentum im Strafrecht | 37 | ||
| b) Sachen im Strafrecht | 39 | ||
| 3. Tathandlungen des § 303 I StGB | 41 | ||
| a) Beschädigen, § 303 I Var. 1 StGB | 41 | ||
| b) Zerstören, § 303 I Var. 2 StGB | 44 | ||
| 4. Verändern des Erscheinungsbilds, § 303 II StGB | 44 | ||
| 5. Strafandrohung | 47 | ||
| II. Gemeinschädliche Sachbeschädigung, § 304 StGB | 47 | ||
| 1. Schutzgut und Tatobjekt | 48 | ||
| 2. Tathandlungen des § 304 StGB | 49 | ||
| 3. Strafandrohung | 50 | ||
| III. Zerstörung von Bauwerken, § 305 StGB | 51 | ||
| 1. Schutzgut und Tatobjekt | 51 | ||
| 2. Tathandlungen des § 305 StGB | 52 | ||
| 3. Strafandrohung | 52 | ||
| IV. Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel, § 305a StGB | 53 | ||
| 1. Schutzgut und Tatobjekt | 53 | ||
| 2. Tathandlungen des § 305a StGB | 54 | ||
| 3. Strafandrohung | 54 | ||
| V. Brandstiftung, § 306 StGB | 54 | ||
| 1. Schutzgut und Tatobjekt | 55 | ||
| 2. Tathandlungen des § 306 StGB | 57 | ||
| 3. Strafandrohung | 58 | ||
| VI. „Sachbeschädigungen sui generis“ | 59 | ||
| 1. Schutzgüter und Tatobjekte | 60 | ||
| a) Eigentum | 60 | ||
| b) Staatliche Rechtsgüter, Rechte und Aufgaben | 60 | ||
| c) Schutz der Allgemeinheit | 61 | ||
| d) Versorgung der Allgemeinheit | 62 | ||
| e) Wichtige Lebensgrundlagen | 64 | ||
| f) Dispositionsbefugnis | 64 | ||
| g) Unklare Schutzrichtung | 65 | ||
| 2. Tathandlungen | 65 | ||
| a) Beschädigen und Zerstören | 65 | ||
| b) Unbrauchbarmachen | 66 | ||
| c) Verunstalten | 67 | ||
| d) Verändern | 67 | ||
| e) Beseitigen, Entfernen oder Ablösen | 68 | ||
| f) Entziehen oder Unterdrücken | 69 | ||
| g) Verüben beschimpfenden Unfugs | 69 | ||
| h) Unkenntlichmachen | 69 | ||
| i) Im Sinn Entstellen | 70 | ||
| 3. Deliktscharakter und Begehungsweise | 70 | ||
| a) Gefährdungsdelikte | 70 | ||
| aa) Abstrakte Gefährdungsdelikte | 70 | ||
| bb) Konkrete Gefährdungsdelikte | 71 | ||
| cc) Eignungsdelikt | 71 | ||
| b) Fahrlässigkeitstatbestände | 72 | ||
| 4. Qualifikationen | 73 | ||
| 5. Besonderheiten im subjektiven Tatbestand | 74 | ||
| 6. Strafandrohung | 75 | ||
| a) Strafrahmen | 75 | ||
| b) Benannte besonders schwere Fälle | 76 | ||
| c) Tätige Reue | 76 | ||
| VII. Fazit: Mehr als Sachen und Beschädigungen | 77 | ||
| C. Praktische Relevanz der Sachbeschädigung | 78 | ||
| D. Analyse der tatbestandlichen Entwicklung | 82 | ||
| 2. Teil: Die Sachbeschädigung im Vergleich | 95 | ||
| A. Vergleich mit den Gesetzen deutschsprachiger Nachbarländer | 95 | ||
| I. Österreich | 96 | ||
| 1. Systematische Einordnung des Delikts | 97 | ||
| 2. Historische Entwicklung | 97 | ||
| 3. Tatbestandsmäßigkeit | 99 | ||
| a) Tatobjekt | 99 | ||
| b) Tathandlungen | 100 | ||
| 4. Qualifikationen | 103 | ||
| 5. Strafrahmen | 106 | ||
| 6. Fazit: Nahezu identischer Schutz in anderem Gewand | 107 | ||
| II. Schweiz | 109 | ||
| 1. Systematische Einordnung des Delikts | 110 | ||
| 2. Historische Entwicklung | 111 | ||
| 3. Tatbestandsmäßigkeit | 113 | ||
| a) Tatobjekt | 113 | ||
| b) Tathandlung | 114 | ||
| 4. Qualifikationen | 115 | ||
| 5. Strafrahmen | 117 | ||
| 6. Fazit: Großer Schutzumfang in kleinem Tatbestand | 118 | ||
| III. Gesamtfazit: Anders ist auch schön | 118 | ||
| B. Vergleich mit anderen Eigentumsdelikten | 119 | ||
| I. Gemeinsamkeiten | 119 | ||
| II. Unterschiede | 123 | ||
| 1. Ausgestaltung der Tatbestände | 123 | ||
| 2. Historische Entwicklung | 126 | ||
| 3. Tatobjekte | 128 | ||
| 4. Erscheinungsbild und Folgen der Delikte | 130 | ||
| 5. Täter | 132 | ||
| 6. Opfer | 136 | ||
| III. Fazit: Ein Vergleich von Äpfeln mit Birnen | 139 | ||
| C. Vergleich mit Parallelen auf zivilrechtlicher Ebene | 139 | ||
| I. Ansprüche wegen verbotener Eigenmacht i.S.d. § 858 I BGB | 140 | ||
| 1. Anspruch wegen Besitzentziehung, § 861 I BGB | 142 | ||
| 2. Anspruch wegen Besitzstörung, § 862 I BGB | 143 | ||
| II. Ansprüche wegen Bestehens einer Vindikationslage, §§ 985ff. BGB | 145 | ||
| 1. Herausgabeanspruch, § 985 BGB | 146 | ||
| 2. Schadensersatz nach Rechtshängigkeit oder bei Kenntnis des Besitzers, §§ 989, 990 I BGB | 147 | ||
| III. Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch, § 1004 I BGB | 149 | ||
| IV. Schadensersatzanspruch, § 823 I BGB | 152 | ||
| V. Fazit: Parallelen, aber kein Gleichlauf | 156 | ||
| 3. Teil: Analyse möglicher Änderungen der Sachbeschädigungsstrafbarkeit | 159 | ||
| A. Verfassungsrechtliche Grundlagen | 159 | ||
| I. Vom Rechtsgüterschutz zum Strafwürdigkeitsbegriff | 159 | ||
| II. Rechtsgüterschutz durch Rechtsgüterbeeinträchtigung | 165 | ||
| 1. Würde des Menschen, Art. 1 I GG | 168 | ||
| 2. Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, Art. 2 I GG | 169 | ||
| 3. Körperliche Bewegungsfreiheit, Art. 2 II 2 GG | 170 | ||
| 4. Gleichheitssatz und Willkürverbot, Art. 3 I GG | 171 | ||
| 5. Bestimmtheitsgebot, Art. 103 II GG | 171 | ||
| 6. Zwischenergebnis: Strafwürdigkeit als Abwägungsentscheidung | 172 | ||
| III. Strafwürdigkeit der Sachbeschädigung | 173 | ||
| 1. Rechtsgüterschutz durch Sachbeschädigungsstrafbarkeit | 175 | ||
| 2. Zivilrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht als mildere Mittel | 177 | ||
| a) Rein zivilrechtlicher Eigentumsschutz als milderes Mittel | 178 | ||
| b) Ordnungswidrigkeitenrecht als milderes Mittel | 185 | ||
| 3. Angemessenheit | 187 | ||
| IV. Fazit: Sachbeschädigungsstrafbarkeit als staatlicher Rechtsgüterschutz | 193 | ||
| B. Zusammenfassung bisher angesprochener Änderungen | 193 | ||
| I. Übersicht | 194 | ||
| II. Chancen und Gefahren | 195 | ||
| C. Die Änderungsüberlegungen im Einzelnen | 200 | ||
| I. Reduzierung der Sachbeschädigungstatbestände | 200 | ||
| 1. Streichung von Qualifikationen | 201 | ||
| 2. Streichung von Tatobjekten des § 304 StGB | 203 | ||
| 3. Fazit: Mehr ist manchmal doch mehr | 204 | ||
| II. Änderungen hinsichtlich der Tatobjekte | 205 | ||
| 1. Ergänzung strafschärfender Tatobjekte | 205 | ||
| a) Verletzung oder Tötung von Tieren | 206 | ||
| b) Dem Täter anvertraute Sache | 217 | ||
| c) Berücksichtigung des Sachwerts oder Schadens | 219 | ||
| 2. Ergänzung von Tatobjekten in § 304 StGB | 223 | ||
| 3. Streichung des Fremdheitserfordernisses | 226 | ||
| III. Änderungen hinsichtlich der Begehungsweisen und Tatmittel | 230 | ||
| 1. Sachentziehung | 230 | ||
| a) Zeitweilige Entziehung | 237 | ||
| b) Dauernde Entziehung | 238 | ||
| c) Absolute Entziehung | 240 | ||
| d) Fazit: Strafwürdigkeit der Sachentziehung – aber wie? | 241 | ||
| 2. Gemeinschaftliche Begehung | 242 | ||
| 3. Mit Waffen oder anderen gefährlichen Werkzeugen | 246 | ||
| IV. Haus- und Familiensachbeschädigung | 250 | ||
| V. Schädigungsabsicht | 253 | ||
| VI. Streichung der Versuchsstrafbarkeit | 257 | ||
| VII. Fahrlässige Sachbeschädigung | 261 | ||
| VIII. Tätige Reue | 264 | ||
| IX. Strafrahmen | 272 | ||
| 1. Beschränkung auf Geldstrafe | 273 | ||
| 2. Reduzierung des Strafrahmens | 275 | ||
| 3. Erhöhung des Strafrahmens | 276 | ||
| X. Umstrukturierung bestehender Sachbeschädigungen | 279 | ||
| XI. Fazit: Ein Delikt mit viel (Verbesserungs‑)Potenzial | 282 | ||
| 4. Teil: Zusammenführung der Änderungsmöglichkeiten | 284 | ||
| Schlussbetrachtung: Sachbeschädigungen und „die gute Sache“ | 290 | ||
| Anhang: Historische und ausländische Strafnormen sowie Entwürfe | 295 | ||
| Literaturverzeichnis | 309 | ||
| Stichwortverzeichnis | 327 |
