Die konzernweite Wissenszurechnung beim Untemehmenskauf
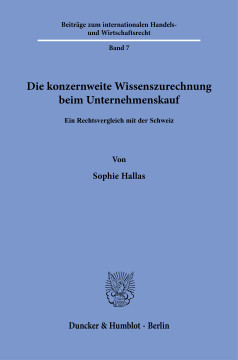
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Die konzernweite Wissenszurechnung beim Untemehmenskauf
Ein Rechtsvergleich mit der Schweiz
Beiträge zum internationalen Handels- und Wirtschaftsrecht, Vol. 7
(2025)
Additional Information
Book Details
Pricing
About The Author
Sophie Hallas studierte Rechtswissenschaften an der Universität Leipzig. Nach der Zweiten Juristischen Staatsprüfung in Dresden erfolgte ihre Promotion an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Seit 2024 ist sie als Notarassessorin im Freistaat Sachsen tätig.Abstract
Ein Unternehmenskauf birgt zahlreiche Haftungsrisiken. Aus diesem Grund untersucht die Autorin die Umstände einer arglistigen Täuschung beim Unternehmenskauf. Auf der Grundlage der aktuellen Rechtsprechung zeigt sie auf, welchen Einfluss eine Due Diligence auf bestehende Aufklärungspflichten eines Verkäufers hat und welche Rolle der Wissenszurechnung beim Unternehmenskauf zukommt. Sodann bereitet die Autorin den aktuellen Forschungsstand zur Wissenszurechnung im Konzern auf und nutzt ihn als Basis zur Entwicklung konkreter Rechtsnormen. Mittels einer rechtsvergleichenden Gegenüberstellung des schweizerischen und deutschen Rechts arbeitet sie den in beiden Ländern praktizierten Umgang mit Wissensorganisationspflichten heraus. Dabei zeigt sie auf, wie eine gesetzliche Verankerung der Wissensorganisationspflichten für Rechtssicherheit sorgen kann.»The Group-Wide Attribution of Knowledge in M&A Transactions. A Legal Comparison with Switzerland«: An M&A transaction involves numerous liability risks. One contributing factor is the lack of a legal basis for attributing knowledge within legal entities and among group companies. The author examines the current state of case law and existing research approaches. On this basis, she develops new legal regulations and demonstrates how this approach can address the existing legal uncertainties.
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 7 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 9 | ||
| Abkürzungsverzeichnis | 16 | ||
| A. Einleitung | 19 | ||
| I. Problemstellung | 19 | ||
| II. Gegenstand der Untersuchung | 21 | ||
| III. Gang der Untersuchung | 23 | ||
| B. Grundsätzliches zum Unternehmenskauf | 25 | ||
| I. Deutschland | 25 | ||
| II. Schweiz | 27 | ||
| III. Rechtsvergleich und Ergebnis | 28 | ||
| C. Die Anfechtung eines Unternehmenskaufvertrages wegen arglistiger Täuschung | 30 | ||
| I. Deutschland | 30 | ||
| 1. Arglistige Täuschung | 32 | ||
| a) Täuschung durch aktives Tun | 32 | ||
| b) Täuschung durch Unterlassen | 32 | ||
| 2. Due Diligence | 35 | ||
| a) Keine Verpflichtung zur Durchführung der Due Diligence | 36 | ||
| b) Keine Verpflichtung zur Gestattung der Due Diligence | 39 | ||
| c) Auswirkungen einer Due Diligence auf bestehende Aufklärungspflichten des Verkäufers | 41 | ||
| d) Auswirkungen einer Nachlässigkeit des Käufers | 46 | ||
| aa) Keine grob fahrlässige Unkenntnis i.S.d. § 442 Abs. 1 S. 2 BGB | 46 | ||
| bb) Möglichkeit eines Mitverschuldens i.S.d. § 254 Abs. 1 BGB | 50 | ||
| II. Schweiz | 51 | ||
| 1. Absichtliche Täuschung | 53 | ||
| 2. Keine Verpflichtung zur Durchführung einer Due Diligence | 56 | ||
| 3. Keine Verpflichtung zur Gestattung einer Due Diligence | 58 | ||
| 4. Auswirkungen einer Nachlässigkeit des Käufers | 59 | ||
| 5. Arglistiges Verschweigen | 60 | ||
| 6. Die Prüfungs- und Rügeobliegenheit nach Art. 201 OR | 61 | ||
| III. Rechtsvergleich und Ergebnis | 64 | ||
| IV. Notwendigkeit einer gesetzlichen Regelung zur Prüfungs- und Rügeobliegenheit nach schweizerischem Vorbild? | 67 | ||
| D. Kein Wissen juristischer Personen? | 69 | ||
| I. „Wissen“ und „Wissenmüssen“ | 69 | ||
| 1. Deutschland | 69 | ||
| 2. Rechtsvergleich und Zwischenergebnis | 72 | ||
| II. Ausgangspunkt: Die juristische Person ist nicht wissensfähig | 72 | ||
| 1. Deutschland | 73 | ||
| 2. Schweiz | 76 | ||
| 3. Rechtsvergleich und Zwischenergebnis | 80 | ||
| III. Das sog. „Aktenwissen“ | 81 | ||
| 1. „Entkopplung“ von der Papierakte | 81 | ||
| a) Deutschland | 81 | ||
| b) Rechtsvergleich mit der Schweiz | 83 | ||
| 2. Von künstlicher Intelligenz generierte und erfasste Informationen | 85 | ||
| a) Deutschland | 85 | ||
| b) Rechtsvergleich mit der Schweiz | 87 | ||
| 3. Zwischenergebnis | 87 | ||
| IV. Die Wissenszurechnung | 88 | ||
| 1. Deutschland | 88 | ||
| 2. Rechtsvergleich und Zwischenergebnis | 89 | ||
| V. Ergebnis | 90 | ||
| E. Arglist durch Wissenszurechnung | 91 | ||
| I. Deutschland | 91 | ||
| 1. Forschungsstand | 91 | ||
| 2. Stellungnahme | 94 | ||
| II. Rechtsvergleich mit der Schweiz | 95 | ||
| III. Ergebnis | 95 | ||
| F. Die Wissenszurechnung beim Unternehmenskauf | 96 | ||
| I. Juristische Personen | 97 | ||
| 1. Wissen bei der Stellvertretung | 97 | ||
| a) Deutschland | 97 | ||
| aa) Vorhandensein von Wissenszurechnungsnormen? | 97 | ||
| bb) § 166 BGB | 97 | ||
| cc) Mehrere Stellvertreter | 98 | ||
| dd) Die ordnungsgemäße Wissensorganisation durch Wissensorganisationspflichten | 99 | ||
| (1) Entwicklung der Rechtsprechung | 100 | ||
| (2) Forschungsstand in der Literatur | 104 | ||
| (3) Stellungnahme | 105 | ||
| (a) „Die ordnungsgemäße Wissensorganisation durch Wissensorganisationspflichten“ als taugliches Wissenszurechnungskriterium | 105 | ||
| (aa) Benachteiligung durch das Gleichstellungsargument? | 105 | ||
| (bb) „Wissen“ oder „Wissenmüssen“? | 107 | ||
| (cc) Unbedingtheit der Zurechnung bei arbeitsteiligen Organisationen? | 109 | ||
| (dd) Fehlende dogmatische Grundlage? | 110 | ||
| (b) Zwischenergebnis | 111 | ||
| (4) Die Neuregelung des § 238a HGB | 111 | ||
| (a) Notwendigkeit | 111 | ||
| (b) Anforderungen | 112 | ||
| (c) Überprüfung | 113 | ||
| (5) Zwischenergebnis | 118 | ||
| ee) Ergebnis | 119 | ||
| b) Schweiz | 119 | ||
| aa) Vorhandensein von Wissenszurechnungsnormen? | 119 | ||
| bb) Art. 32 OR | 119 | ||
| cc) Mehrere Stellvertreter | 120 | ||
| dd) Die sog. „Wissenszusammenrechnung“ | 121 | ||
| ee) „Die ordnungsgemäße Wissensorganisation durch Wissensorganisationspflichten“ | 122 | ||
| c) Rechtsvergleich | 126 | ||
| d) Zwischenergebnis | 127 | ||
| 2. Wissenszurechnung auf „Organebene“ | 127 | ||
| a) Deutschland | 127 | ||
| aa) Organ | 127 | ||
| bb) § 166 BGB | 128 | ||
| (1) § 166 Abs. 1 BGB | 128 | ||
| (2) § 166 Abs. 2 BGB | 130 | ||
| (3) Zwischenergebnis | 131 | ||
| cc) § 31 BGB | 131 | ||
| dd) Die Neuregelung des § 238a HGB | 132 | ||
| ee) Zwischenergebnis | 133 | ||
| b) Schweiz | 133 | ||
| aa) Organ | 133 | ||
| bb) Forschungsansätze zur Wissenszurechung | 134 | ||
| (1) Literatur | 135 | ||
| (a) „Theorie der absoluten Wissenszurechnung“ | 135 | ||
| (b) „Theorie der relativen Wissenszurechnung“ | 137 | ||
| (c) „Fiktionstheorie“ bzw. „Vertretertheorie“ | 137 | ||
| (d) „Funktionstheorie“ | 138 | ||
| (e) „Die ordnungsgemäße Wissensorganisation durch Wissensorganisationspflichten“ | 138 | ||
| (2) Rechtsprechung | 138 | ||
| (3) Rechtsvergleich und Ergebnis | 141 | ||
| 3. Wissen des Organs | 142 | ||
| a) Deutschland | 142 | ||
| aa) AG | 142 | ||
| (1) Vorstand | 142 | ||
| (2) Aufsichtsrat | 143 | ||
| (a) Innerhalb des Zuständigkeitsbereichs erworbenes Wissen | 143 | ||
| (b) Außerhalb des Zuständigkeitsbereichs erworbenes Wissen | 144 | ||
| (c) Auswirkungen des § 238a HGB i.V.m. § 21a Abs. 3 AktG | 145 | ||
| (3) Zwischenergebnis | 145 | ||
| bb) Die Gesellschafterversammlung der GmbH | 146 | ||
| (1) Innerhalb des Zuständigkeitsbereichs erworbenes Wissen | 146 | ||
| (2) Außerhalb des Zuständigkeitsbereichs erworbenes Wissen | 147 | ||
| (3) Auswirkungen des § 238a HGB | 148 | ||
| (4) Zwischenergebnis | 148 | ||
| b) Rechtsvergleich mit der Schweiz | 149 | ||
| c) Zwischenergebnis | 150 | ||
| 4. Privat erlangtes Wissen | 150 | ||
| a) Deutschland | 150 | ||
| b) Rechtsvergleich und Zwischenergebnis | 154 | ||
| 5. Wissen ausgeschiedener bzw. verstorbener Organmitglieder | 155 | ||
| a) Deutschland | 155 | ||
| b) Rechtsvergleich und Zwischenergebnis | 157 | ||
| 6. Wissen sonstiger Beteiliger | 158 | ||
| a) Deutschland | 158 | ||
| aa) Wissensvertreter | 158 | ||
| bb) Erfüllungsgehilfen | 160 | ||
| cc) „Einfache Mitarbeiter“ | 162 | ||
| (1) Grundsätzliches | 162 | ||
| (2) Wissen übernommener Mitarbeiter | 162 | ||
| (3) Der Auskunft gebende Mitarbeiter der Zielgesellschaft | 163 | ||
| b) Rechtsvergleich und Zwischenergebnis | 164 | ||
| 7. Ergebnis | 167 | ||
| II. Konzern | 167 | ||
| 1. Grundsätzliches zum Konzern | 169 | ||
| a) Deutschland | 169 | ||
| b) Rechtsvergleich mit der Schweiz | 170 | ||
| 2. Ausgangspunkt: Keine Wissensfähigkeit des Konzerns | 173 | ||
| a) Deutschland | 173 | ||
| b) Rechtsvergleich und Zwischenergebnis | 174 | ||
| 3. Keine gesetzliche Normierung der Wissenszurechnung im Konzern | 175 | ||
| 4. Allgemeine Wissenszurechnungsgründe | 175 | ||
| a) Bloße Konzernangehörigkeit kein Zurechnungsgrund | 176 | ||
| aa) Deutschland | 176 | ||
| bb) Rechtsvergleich und Zwischenergebnis | 177 | ||
| b) Wissenszurechnung durch Weisung oder Veranlassung | 177 | ||
| aa) Deutschland | 177 | ||
| (1) Vertragskonzern | 177 | ||
| (2) Faktischer Konzern | 179 | ||
| bb) Rechtsvergleich mit der Schweiz | 180 | ||
| c) Die ordnungsgemäße Wissensorganisation im Konzern | 181 | ||
| aa) Anforderungen der Rechtsprechung | 182 | ||
| (1) Deutschland | 182 | ||
| (2) Rechtsvergleich mit der Schweiz | 183 | ||
| (3) Zwischenergebnis und weiteres Vorgehen | 183 | ||
| bb) Fallkonstellation 1: Das Konzernunternehmen hatte keine Möglichkeit zur Wissensorganisation oder zum Informationszugriff | 184 | ||
| (1) Keine Konzernleitungspflicht | 184 | ||
| (a) Deutschland | 184 | ||
| (b) Rechtsvergleich mit der Schweiz | 186 | ||
| (2) Keine allgemeine Wissensorganisationspflicht im Konzern | 188 | ||
| (a) Deutschland | 188 | ||
| (aa) Forschungsstand | 188 | ||
| (bb) Stellungnahme | 190 | ||
| (cc) Keine Neuregelung einer konzernweiten Wissensorganisationspflicht | 191 | ||
| (b) Rechtsvergleich mit der Schweiz | 192 | ||
| (3) Ergebnis | 194 | ||
| cc) Fallkonstellation 2: Das Konzernunternehmen hatte die Möglichkeit zur Wissensorganisation oder zum Informationszugriff | 194 | ||
| (1) Die „Beherrschbarkeit des Informationsflusses“ | 195 | ||
| (a) Deutschland | 195 | ||
| (aa) Informationsansprüche von „oben nach unten“ | 197 | ||
| (bb) Informationsansprüche von „unten nach oben“ | 198 | ||
| (cc) Informationsansprüche von zwischen abhängigen Unternehmen | 200 | ||
| (b) Rechtsvergleich mit der Schweiz | 201 | ||
| (c) Zwischenergebnis | 203 | ||
| (2) Wissenszurechnung bei eingerichtetem konzerninternem Informationsorganisationssystem | 204 | ||
| (a) Deutschland | 204 | ||
| (b) Rechtsvergleich mit der Schweiz | 205 | ||
| (3) „Auslagerung eines Arbeitsbereichs auf ein anderes Konzernunternehmen“ | 206 | ||
| (a) Deutschland | 206 | ||
| (b) Rechtsvergleich mit der Schweiz | 208 | ||
| (4) Mehrfach tätige Personen innerhalb des Konzerns | 209 | ||
| (a) Deutschland | 209 | ||
| (b) Rechtsvergleich mit der Schweiz | 211 | ||
| (5) Erzeugtes Vertrauen | 213 | ||
| (a) Deutschland | 213 | ||
| (b) Rechtsvergleich mit der Schweiz | 213 | ||
| dd) Ergebnis und Schlussfolgerungen | 215 | ||
| 5. Neuregelung der Wissenszurechnung im Konzern | 216 | ||
| a) Notwendigkeit einer gesetzlichen Regelung | 216 | ||
| b) Rechtliche Zulässigkeit der Neuregelung | 217 | ||
| aa) Konzernrechtliche Zurechnungsnormen des AktG | 218 | ||
| bb) Schlussfolgerungen für eine konzernweite Wissenszurechnung | 219 | ||
| c) Die Neuregelung des § 21a AktG | 220 | ||
| aa) Anforderungen | 220 | ||
| bb) Überprüfung | 220 | ||
| d) Zwischenergebnis | 222 | ||
| 6. Ergebnis | 222 | ||
| III. Gesamtergebnis | 223 | ||
| G. Grenzen einer konzernweiten Wissenszurechnung | 225 | ||
| I. Sonderfall 1: Due Diligence im Konzern | 226 | ||
| 1. Deutschland | 226 | ||
| a) AG-Konzern | 227 | ||
| aa) Vertragskonzern | 227 | ||
| bb) Faktischer Konzern | 230 | ||
| b) GmbH-Konzern | 231 | ||
| 2. Rechtsvergleich und Zwischenergebnis | 234 | ||
| 3. Deutschland | 239 | ||
| 4. Rechtsvergleich und Zwischenergebnis | 243 | ||
| II. Ergebnis | 244 | ||
| H. Zulässigkeit individualvertraglicher Regelungen zur Kenntnis und Wissenszurechnung | 246 | ||
| I. Deutschland | 246 | ||
| 1. Modifikation des gesetzlichen Haftungsregimes | 247 | ||
| a) Keine wirksame vertragliche Beschränkung auf relevanten Wissensträger | 247 | ||
| aa) Status quo | 247 | ||
| bb) Auswirkungen von § 238a HGB und § 21a AktG | 249 | ||
| b) Der offengelegte Mangel | 250 | ||
| 2. Schaffung eines eigenen Haftungsregimes | 252 | ||
| II. Rechtsvergleich mit der Schweiz | 253 | ||
| III. Ergebnis | 256 | ||
| I. Erkenntnisse in Thesen | 257 | ||
| Literaturverzeichnis | 261 | ||
| Gesetzgebungsmaterialien und sonstige Internetquellen | 277 | ||
| Stichwortverzeichnis | 278 |
